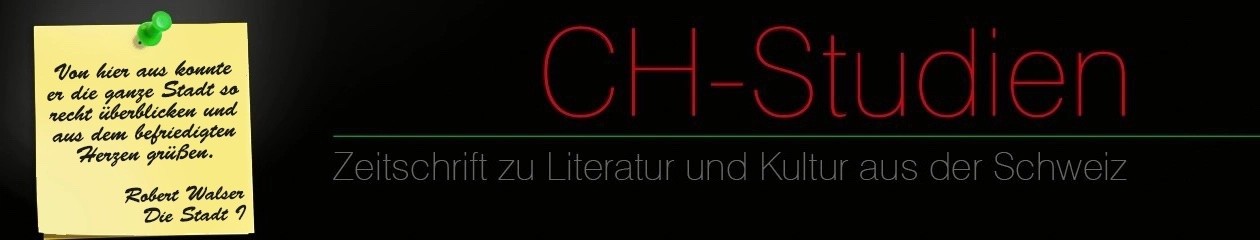Harry Gmür
Die am 9. August 1963 gegründete Mittelwest-Region soll nach dem umstrittenen Zensus zweieinhalb Millionen Einwohner zählen, die Hauptstadt Benin deren 350000. Es gibt Ibos darunter und Yorubas, doch gehören die meisten kleineren Stämmen an, die auch besondere Sprachen, namentlich Edo und Urhobo, sprechen. Das Abgeordnetenhaus besteht aus 65 Abgeordneten, von denen 55 der allein regierenden National Convention of Nigerian Citizens zuzuordnen sind. Die Opposition setzt sich aus neun Abgeordneten der sogenannten „Midwest Democratic Front“ und einem Mitglied der „Action Group“ zusammen. Daneben gibt es ein House of Chiefs mit 55 Mitgliedern und geringeren Befugnissen. An der Spitze der Regierung steht der 1911 geborene ehemalige Rechtsanwalt Chief Dennis Osadebay, der „Kapitän des Midwest-Staat-Schiffs”, ein Mann, dem seine Anhänger die höchsten Eigenschaften nachrühmen: Er sei ein vollendeter Redner, ein glänzender Journalist, ein begabter Dichter, Autor der hundert Gedichte umfassenden Sammlung „Afrika singt“, deren Verse oft vom britischen Rundfunk wiedergegeben wurden, ein Liebhaber auch europäischer Musik (Schuberts „Ave Maria” sei sein Lieblingsstück …) und vor allem ein starker, dabei charmanter, wahrheitsliebender, geistvoller, fairer, ehrlicher und humaner politischer Führer. Osadebay wirkte früher als Sekretär und Präsident der „Ibo State-Union“, dann selbstverständlich als führendes Mitglied der National Convention of Nigerian Citizens. Vor der Bildung der Mittelwest-Region war er der offizielle Oppositionsführer im Abgeordnetenhaus von Ibadan, und 1960 wurde er zum Präsidenten des Senats der Föderation gewählt.
Über dem ganzen modernen Staatsaufbau aber schwebt als höchste Spitze und wenigstens symbolische Autorität der Oba von Benin. Seine Majestät Akenzua II., der Erbe eines uralten glanzvollen Königsthrons, der im Gegensatz zu den Meisten Yorubathronen in strenger männlicher Erbfolge weitervererbt wurde. Das Reich Benin soll sich auf dem Höhepunkt seiner Machtentfaltung vom Nigerstrom bis in die Gegend von Accra in Ghana erstreckt haben. Akenzua II. ist zweifellos der bedeutendste aller Obas in Nigeria. Der Palast zeigt sich von außen lediglich als eine schmucklose, ja fensterlose rote Lehmmauer, nur halb so hoch wie der Wall am Stadtrand, jedoch von erstaunlicher Länge: An einer Front erreicht sie nahezu einen Kilometer. Ich stand rechtzeitig vor dem Tor – genauer gesagt: einer ganz gewöhnlichen Tür aus grobem, grüngestrichenem Holz, wie man sie bei uns etwa für einen Weinkeller verwendet. Sie befand sich an der Südwestfront, die Mauer spendete zu dieser Tagesstunde nicht den geringsten Schatten. Der Schweiß rann mir in Bächen von der Stirn; mein Taschentuch war schon derart durchnässt, dass es ganz zwecklos war, das Gesicht damit zu betupfen. Eine Haarsträhne war mir auf die Nase gefallen und klebte daran. Und die verdammte Krawatte war so nass, dass sie sich zusammenzog und jegliche Form verlor. Mit jedem Versuch, sie zurechtzudrehen, wurde sie nur noch schadhafter und rebellischer. Als ich in meine Tasche griff, um meinen kleinen Kamm herauszuklauben und mein Haar in Ordnung zu bringen, fand ich ihn nicht; er war mir wohl im Wagen aus der Tasche herausgerutscht. Ausgerechnet in diesem Augenblick der Schwäche und Verwirrung öffnete sich die grüne Holztür, und ein junger Bursche in Kniehose und mit nacktem Oberkörper forderte mich auf, vor seine Hoheit zu treten! Wenn ich mich recht erinnere, ging es vorerst drei Treppenstufen hinunter in einen Raum, der mir im ersten Augenblick, nach dem grellen Sonnenlicht draußen, wie ein dunkler Keller vorkam. Eine Vorhalle, von der eine Flucht von Korridoren zu den königlichen Gemächern führte? Als sich das Auge umgestellt hatte, erkannte ich den Irrtum: Ich stand bereits am Anfang des großen, wenn auch nicht sehr hohen Saales, in dem der Oba thronte. Der Fußboden war mit Teppichen Ausgelegt. Sonst verdeckte kein Möbelstück den Anblick der kahlen, ungeschmückten, völlig fensterlosen Wände. Bloß ganz hinten, am entgegengesetzten Ende, stand ein größerer Stuhl – der Thron –, umringt von einem Tischchen und einer Anzahl von Lehnsesseln jenes einfachen Typs, wie ich ihn im „Chris-bo“-Hotel und überall in diesem Lande gefunden hatte. Bloß, dass die Kissen und die Federn darunter hier besonders abgenutzt waren; es war nicht schwierig, sich hinzusetzen, doch sank man sehr tief und es war ein Kunststück, sich wieder zu erheben – eine Vorkehrung, die ihren guten Sinn haben mochte: Man saß so tief zu Füßen seiner Hoheit.
,,Seine Majestät,, empfing mich im Übrigen sehr gnädig. Der Oba tat, als nähme er keine Kenntnis von meinem protokollwidrig verwahrlosten Zustand, vielleicht bemerkte er ihn ja auch wirklich nicht. Er hieß mich nach einem ganz gewöhnlichen Händedruck sitzen und fragte, was ich trinken möchte. Ein Bier oder einen Orangensaft. Der 65-Jährige erschien mir als ein recht schlanker Mann mit feinen, durchgeistigen Gesichtszügen. Er trug ein schlichtes weißes, wie ein Priesterrock bis auf die Füße fallendes Hemd und eine kleine weiße Mütze, wie sie schon seine Vorfahren getragen haben sollen – seit Jahren sein offizielles Herrschergewand -, und benützte eine Brille. Er sprach fließend Englisch, vielleicht mit etwas ältlicher Stimme, und gab sich in jeder Hinsicht natürlich und ohne überhebliche Pose. Er stellte mir zunächst einen zweiten Oba vor, ich verstand nicht aus welcher Stadt, einen etwas jüngeren und robusteren Mann, der neben mir saß, wie ich selbst als Besucher, sich aber später zurückzog. „Wir stehen hier in Afrika um viele Jahrhunderte hinter Europa zurück”, bemerkte Akenzua, der übrigens in seiner Jugend den Namen Edokpahogbuyumwun getragen hatte (der Leser versuche einmal, dies nachzusprechen oder gar auswendig zu lernen …). Ich erwiderte, dies gelte doch zur Hauptsache nur für den Bereich der industriellen Technik und der modernen Wissenschaften, wo in einigen Jahrzehnten angestrengter Arbeit das meiste nachgeholt werden könne, nicht für andere Gebiete menschlichen Daseins und menschlicher Entwicklung. Ich erklärte meine Absicht, in Europa etwas über die Geschichte des Königreichs Benin zu erzählen, um der dem Ansehen Afrikas abträglichen kolonialistischen Legende von der Geschichtslosigkeit des Kontinents entgegenzutreten. „Benin ist ein sehr altes Königreich”, sagte der Oba. „Die Stadt Oba wurde im 12. Jahrhundert gegründet. Wir führen die erste Dynastie der Benin sogar auf das 10. Jahrhundert zurück. Nach der Überlieferung soll das erste Oba der Benin, Ogiso, ein Sohn Oduduwas von Ilfe, des Stammvaters der Yoruba, gewesen sein. Doch die Benin müssen sich unabhängig von den Yoruba entwickelt haben.” Die Benin seien ein sehr kriegerisches Volk gewesen, mit einem Heer, das bis auf hunderttausend Mann gebracht werden konnte. Berühmt seien Benins Handwerker und Künstler gewesen – und sie seien es auch heute noch. Schon im 15. Jahrhundert habe der Handel mit den Portugiesen eingesetzt, später ebenfalls mit den Engländern und Niederländern, die mit dem Schiff den Fluss hinauffuhren, um Pfeffer, Palmöl, Korallenketten und Elefantenzähne zu holen. Der Oba sprach nicht davon, doch wissen wir es aus anderen Quellen, dass Benin nicht zuletzt Sklaven exportierte. Grundlage dieses Sklavenhandels bildete die Tatsache, dass Benin dank seiner kriegerischen Überlegenheit jederzeit in der Lage war, erfolgreiche Überfälle auf seine Nachbarn zu unternehmen, und dass der König alle seine Untertanen grundsätzlich als seine Leibeigenen betrachtete. Überhaupt entnehmen wir den lebendigen Schilderungen des Amsterdamer Arztes Dapper aus dem 17. Jahrhundert (bzw. einer zeitgenössischen Übersetzung), dass der König durchaus als ein Despot „ja als Wüterich“ regierte. Der damalige habe tausende Frauen und Konkubinen besessen (Akenzua II. besitzt ihrer bloß neun, mit achtzig Kindern). Nach der Thronbesteigung hätten die Könige aus Sorge um ihre Sicherheit alle ihre Brüder aus dem Wege räumen oder höchstens bis zum 25. Lebensjahr leben lassen – nicht anders als gewisse türkische Sultane. Aus Dappers Darstellung geht hervor, dass es sich bei den Benin keineswegs um eine primitive Stammesgemeinschaft, sondern um ein gewiss aller demokratischen Rechte beraubtes – das war in Europa damals im Prinzip nicht anders –, aber recht hochentwickeltes und organisiertes Volk handelte, das vielen seiner Nachbarn in mancher Hinsicht weit überlegen war. Akenzua II. ist nun bestimmt kein Despot mehr, sondern ein aufgeklärter und zudem bloß noch formeller Herrscher, der nur dank seinem Ansehen und seiner persönlichen Aktivität direkten politischen Einfluss ausübt. „Er verfügt theoretisch immer noch über sämtliche Grundstücke in seinem Herrschaftsbereich, aber das hat bloß symbolische, keine praktische Bedeutung“, hatte mir Curtis gesagt. Er besitze außer dem Palast etliche Häuser in der Stadt, sei auch an Kautschukplantagen beteiligt und finanziell nicht zu bedauern. Dagegen habe er sich unbestreitbare Verdienste im Kampf für die Unabhängigkeit Nigerias und, noch entschiedener, für die Gründung des Mittelweststaates erworben.
In der Tat bemerkte der Oba zu mir, die Kolonialperiode sei eine sehr schlechte Zeit gewesen. Und er erinnerte daran, dass sein Großvater, König Ovonramwen, der letzte unabhängige König von Benin vor ihm selbst, nach der Besetzung der Stadt durch die englische „Strafexpedition“ im Jahre 1897 nach Calabar deportiert worden und dort, als er selbst, der Enkel, fünfzehnjährig war, im Exil gestorben sei. Nach dem Bericht Akenzuas hatte er bis dahin mit seinen Eltern in einem Privathaus außerhalb des Palastes gelebt und eine gewöhnliche öffentliche Schule besucht, in der der Lehrer auch ihm gegenüber mit der Peitsche nicht sparsam umging. 1914 zog dann sein Vater als Oba Eweka II. in den Palast, und er selbst wurde nach der Tradition dem Orakelpriester des Königs zur weiteren Erziehung übergeben. Später vervollständige er seine Bildung auf einem College in Lagos und bekleidete, zurückgekehrt nach Benin, einfachere und höhere administrative und richterliche Posten, bis er, nach seines Vaters Tod 1933, als König in den Palast übersiedelte. Als der Kampf gegen die britische Herrschaft ernste Formen anzunehmen begann, stürzte sich Akenzua in die aktive Politik. 1947 wurde er Mitglied des Westparlaments in Ibaden und in demselben Jahr zum Mitglied des Legislativrates von Nigeria ernannt. Nach der Unabhängigkeit aber, vor dem Referendum über die Schaffung des Mittelweststaates, bereiste er den mittleren Westen in seiner ganzen Länge und Breite, um die Bevölkerung von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Region zu schaffen. Ein kluger, progressiver Beobachter, der die Dinge etwas kritischer betrachtet, als der junge Curtis, bemerkte allerdings später mir gegenüber, der Aba von Benin habe gewisse Fehler gemacht, die ihn Sympathien gekostet hätten: „Er hätte sich mit seiner Rolle als eine Art konstitutioneller Monarch wie der König von England begnügen und lediglich hinter den Kulissen wirken sollen. Stattdessen war er einmal aktives Mitglied der Action Group, einmal der National Convention of Nigerian Citizens, und stieß so Leute aus allen Lagern vor den Kopf. Aber an seiner persönlichen Integrität ist nicht zu zweifeln.“
Es war offenbar nicht möglich, außer dem kahlen und trotz des Leuchters reichlich dunklen Thronsaal etwas vom Inneren des Palastes zu sehen. Ich hatte bei Dapper – der im 17. Jahrhundert natürlich nicht die gleichen Ansprüche an Komfort stellte wie unsereiner – immerhin gelesen: „Er ist in viele prächtige Wohnungen eingetheilet und hat schöne viereckige Lustgänge, die ungefähr so groß sind als die Börse zu Amsterdam. Doch einer ist größer als der andere. Das Dach derselben steht auf hölzernen Säulen, welche von unten bis oben mit Messing überzogen, darauf ihre Kriegstoten und Feldschlachten sind abgebildet. Alles wird sehr reinlich unterhalten. Die meisten königlichen Wohnungen sind mit Palmenblättern überdeckt anstatt viereckiger Blätter, und ein jeder Giebel ist mit einem Türmlein gezieret, welches oben spitz zuläuft. Darauf stehen Vögel von Kupfer gegossen, mit ausgebreiteten Flügeln, sehr künstlich nach dem Leben gebildet.“
Vieles hatten die Engländer inzwischen zerstört und geplündert. Andererseits hatte mir Curtis berichtet, die Wohnräume der königlichen Familie seien nicht schlecht ausgestattet, unter anderem mit einer Klimaanlage. Dagegen bot mir der Oba freundlicherweise eine Besichtigung seines Schreins an, der in einem besonderen Hof wenig außerhalb des Palastes (jedenfalls führte der Weg mich durch das Freie) aufbewahrt war. Der Oba empfahl mir natürlich den Besuch des nahen Kunstmuseums. „Viele unserer Kunstschätze befinden sich ja heute im Ausland, in London, auch in Berlin“, klagte er, „aber was wir behalten haben, ist wohl immer noch sehenswert.“ Der König geleitete mich, durch keine Etikette oder Prestigerücksichten gehindert, durch den ganzen langen Saal bis zur Ausgangstür und trat mit mir hinaus auf den Vorplatz. Er empfand wohl selbst das Bedürfnis nach etwas Bewegung sowie frischer Luft und Sonne nach dem langen sitzenden Aufenthalt in der kellerartigen Atmosphäre. Ungezwungen plauderte er draußen, unter den Blicken der wenigen anwesenden Untertanen, noch ein Weilchen mit mir, dann verabschiedete er sich auf die liebenswürdigste Art.
In: Harry Gmür: Reportagen von links. Vier Jahrzehnte Kampf gegen Faschismus und Kolonialismus. Europa Verlag, 2020 Zürich, S. 263-270.
Dem Europa-Verlag sei für die Genehmigung zur Veröffentlichung des vorliegenden Beitrags herzlich gedankt (Copyright © Europa Verlag in Europa Verlage GmbH)