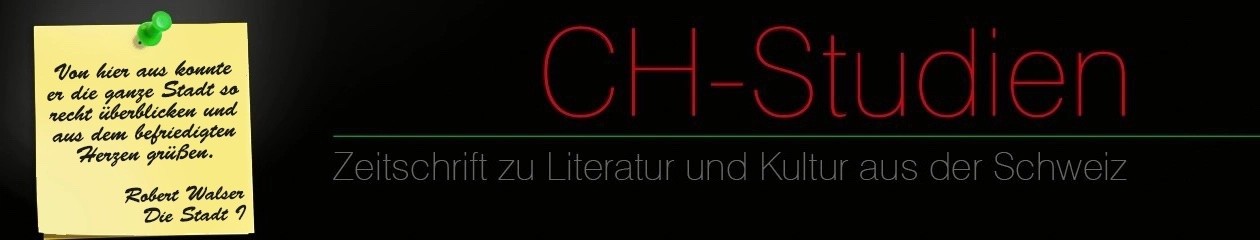Natalia Czudek, Universität Wrocław
Seit der Gründung der internationalen Forschungsgruppe für deutschsprachige Schweizer Literatur im Jahre 2005 auf der ersten von Isabel Hernández und Ofelia Martí Peña organisierten Tagung in Madrid und Salamanca fanden regelmäßig Folgetagungen statt, darunter in Wroclaw (Dariusz Komorowski), Bergen (Beatrice Sandberg), Porto (Gonçalo Vilas-Boas, Maria Teresa de Oliveira), Glasgow (Malcolm Pender), Maribor (Vesna Kondrič Horvat), Szczecin (Dorota Sośnicka), Bern (Dominik Müller, Corinna Jäger Trees, Daniel Rothenbühler) und Dublin (Jürgen Barkhoff). Aus jedem der bisherigen Treffen ist ein Sammelband hervorgegangen, der in seiner Gesamtheit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Schweizer Literatur darstellt.
Vom 2. bis 4. Oktober 2024 bot die von Anna Fattori (Rom) organisierte Konferenz erneut eine wissenschaftliche Austauschplattform. Expert:innen zur Deutschschweizer Literatur aus Spanien, Slowenien, Portugal, den USA, der Schweiz, Polen, der Slowakei, Irland und Italien versammelten sich in der Villa Mondragone in Frascati, um die vielfältigen Zusammenhänge zwischen deutschsprachiger Schweizer Literatur und klassischer Tradition aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Die Vortragenden näherten sich dem Begriff des Klassikers aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ein Großteil der Beiträge fokussierte sich auf Schweizer Autor:innen, in deren Werk sich Anspielungen auf den klassischen Kanon oder die Weltliteratur finden. Cervantes’ Einfluss wurde im Grünen Heinrich und in den Züricher Novellen von Gottfried Keller diskutiert (ISABEL HERNÁNDEZ, Madrid), Dante zusammen mit Gerold Späths Commedia (NEVA ŠLIBAR, Ljubljana), während die Synthese von Motiven aus antiken Mythen, biblischen Erzählungen und der einsamen Szenerie der Robinsonade in Salomon Gessners Schäferdichtung Der erste Schiffer kommentiert wurde (ANNA FATTORI, Roma). Hendrik Ibsens klassisches Drama Ein Volksfeind (1882) und seine Neuinterpretation in Walter Vogts Stück Typhos (1972) bildeten den Gegenstand des Referats von BARBARA POGONOWSKA (Katowice). In Ibsens Werk wird der Konflikt zwischen Umweltbedürfnissen und wirtschaftlichen Interessen aufgegriffen, eine Perspektive, die Vogt einnimmt und aktualisiert. Ein besonderes Augenmerk richtete man auch auf die Bibel als intertextuelle Referenz. Im Fokus der Betrachtung standen dabei theologische Zusammenhänge in Frischs Stiller (DANIEL ANNEN, Schwyz), ökokritische Perspektive in Hugo Loetschers Noah. Roman einer Konjunktur (NATALIA CZUDEK, Wrocław) und Genesis-Bezüge in Peter Stamms Roman Sieben Jahre (JÁN JAMBOR, Bratislava).
Drei Vorträge behandelten ein breiteres Spektrum klassischer Bezüge. DOROTA SOŚNICKA (Szczecin) analysierte die Werke von Zsuzsanna Gahse und entdeckte darin zahlreiche, teils nuancierte und diskrete Anspielungen auf Autoren wie Goethe, Cervantes, E. T. A. Hoffmann, Saint-Exupéry, Petrarca, Boccaccio, und andere. DANIEL ROTHENBÜHLER (Biel/Bienne) nahm die Werke von Ariane von Graffenried, einer Vertreterin der Spoken Word-Bewegung „Bern ist überall”, unter die Lupe. In seiner Untersuchung identifizierte er zahlreiche Bezüge zu globalen und schweizerischen Literaturklassikern. VESNA KONDRIČ HORVAT (Maribor) analysierte die Rolle der Klassik in Fritz Zorns Mars (1975), wo eine strikte Dichotomie zwischen geschätzten Klassikern wie Goethe und Michelangelo (aufgrund ihrer historischen Distanz) und verunglimpften Modernen wie Brecht oder Picasso (aufgrund ihrer zeitgenössischen Präsenz) auftaucht.
Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung lag auf dem Schaffen von angesehenen Schweizer Autor:innen. So widmete sich ein Beitrag von MADELEINE BETSCHART (Neuchâtel) Friedrich Dürrenmatt und den mythologischen Motiven seiner visuellen und literarischen Kunst, während JÜRGEN BARKHOFF (Dublin) die kontinuierliche Auseinandersetzung Thomas Hürlimanns mit dem herausragenden und prägenden Schweizer Klassiker Gottfried Keller beleuchtete. KARIN BAUMGARTNER (Utah) analysierte Johanna Spyris Heidis Lehr- und Wanderjahre (1880) durch die Linse des „Mythos Berg” und zeigte auf, wie Spyri dem Bild der Berge als Domäne der Männerwelt entkam, indem sie es für Frauen und andere marginalisierte Gruppen öffnete. Diesem Werk wird Arno Camenischs Sez Ner (2009) gegenübergestellt, das ebenfalls geschlechterkritische Perspektiven entwickelt. GONÇALO VILAS-BOAS (Porto) stellte eine Untersuchung zum literarischen Archetypus von Wilhelm Tell vor und zeigte, wie diese Figur trotz ihrer fraglichen historischen Existenz als Legende und kulturelles Symbol fortlebt.
Dem Schweizer Klassiker des 20. Jahrhunderts Robert Walser waren drei weitere Beiträge gewidmet. ALEXANDER JAKOVLJEVIC (Szczecin) erörterte die zeitgenössische literarische Umgestaltung und Aneignung von Texten und Figuren Schillers und Dostojewskis durch Walser. Parallelen wurden beispielsweise in den Geschwister-Konstellationen in Dostojewskis Die Brüder Karamasow (1880) und Walsers Die Geschwister Tanner (1907) gefunden. LUKAS GLOOR (Bern) warf in seinem Referat zunächst die Frage auf, ob Walser tatsächlich als Klassiker zu bezeichnen ist und untersuchte dann, wie zeitgenössische Autor:innen, insbesondere diejenigen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihren Werken mit dem literarischen Erbe Walsers umgehen. Wie DARIUSZ KOMOROWSKI (Wrocław) in seinem Vortrag darlegte, setzt sich Lukas Linder in seinem prosaischen und dramatischen Werk intensiv mit Robert Walser auseinander, was z. B. am Motiv der „kugelrunden Null” deutlich wird, das beide Autoren auf unterschiedliche Weise ausgestalten.
Aus einer anderen Perspektive griff das Konferenzthema DOMINIK MÜLLER (Genf) auf. Er beleuchtete die Relevanz der Klassikerpflege in der Schweiz vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und enthüllte ihre Funktion als strategisches Instrument der Schweizer Kulturpolitik, das darauf abzielt, Neutralität zu wahren und gleichzeitig die Nation vom Krieg zu distanzieren. Nach dem Krieg sollte die Klassikerpflege ideologische Spaltungen überbrücken – oder sie zumindest kaschieren.
Alle Tagungsbeiträge unterstrichen, dass die Auseinandersetzung mit der Klassik, auch mit dem eigenen, schweizerischen Kanon, die Deutschschweizer Literatur entscheidend geprägt hat und weiterhin prägt. Aktuelle Forschungsansätze eröffnen dabei neue Einblicke in dieses vielschichtige Verhältnis. Betont wurde auch die dynamische Wechselwirkung zwischen Tradition und Moderne im literarischen Schaffen, indem Schweizer Autor:innen klassische Stoffe, Themen und Erzählformen aufnehmen, umgestalten und mit neuen Fragestellungen in Dialog bringen. Die geführten Diskussionen und gewonnenen Erkenntnisse trugen zu einem vertieften Verständnis der Literatur der deutschsprachigen Schweiz bei und lieferten wertvolle Anregungen für die weitere Forschung. Abschließend wurde die darauffolgende Konferenz, die 2026 in Katowice stattfinden wird, angekündigt.