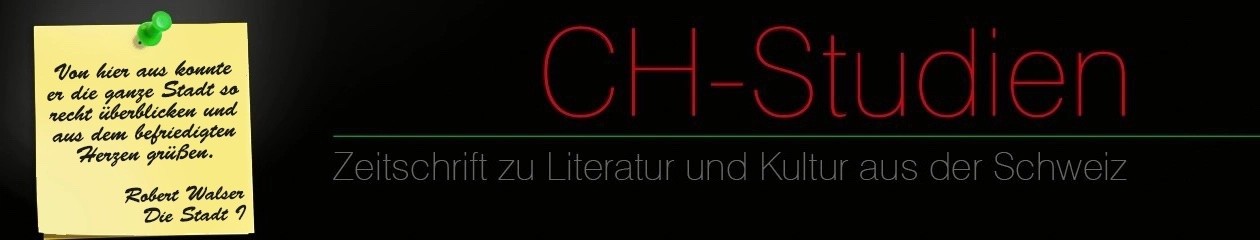Michael Braun, Universität Köln
Bezüge zu Gottfried Keller, dem Ahnherren der modernen Schweizer Literatur, finden sich verstreut in Thomas Hürlimanns Werken. Untersuchen lässt sich diese intertextuelle Relation als ein kontrafaktisches Schreiben, bei dem es weniger auf das ankommt, worauf referiert wird (die Schweiz als Fassadennation, die suburbane Zersplitterung, die metaphysische Obdachlosigkeit, die Verwilderung der Medien), als vielmehr auf den Modus, wie diese Referenzen hergestellt werden: im anekdotischen Framing, in grotesken Spiegelungen, im surrealistischen Setting, in komischen Katastrophen. Es wird gezeigt, wie Hürlimanns Prosasammlung Die Satellitenstadt (1992) im Rekurs auf Kellers Leute von Seldwyla (1855/1874) verwickelte und verwinkelte Vater- und Mutter-Sohn-Geschichten, Heimkehrparabeln und Verhängnis-Novellen mit glücklichem Ende erzählt.
Schlüsselwörter: Intertextualität, Kontrafaktur, Groteske und Ironie, Novelle, modernes Schweizer Erzählen, Symbolik von Katze und Kater, Gottfried Keller, Nietzsche
The People of S. Rewritings of Gottfried Keller in Thomas Hürlimann’s Stories „The Satellite City”
References to Gottfried Keller, the forefather of modern Swiss literature, can be found scattered throughout Thomas Hürlimann’s works. This intertextual relationship can be analysed as counterfactual writing, in which it is less important what is being referenced (Switzerland as a façade nation, suburban fragmentation, metaphysical rooflessness, the wildness of the media) than how these references are made: in anecdotal framing, in grotesque reflections, in surrealistic settings, in comic catastrophes. It will be shown how Hürlimann’s prose collection Die Satellitenstadt (1992), with reference to Keller’s novella cycle Leute von Seldwyla (1855/1874), tells intricate and twisted father and mother-son stories, homecoming parables and fateful novellas with happy endings.
Keywords: Intertextuality, counterfactual storytelling, grotesque and irony, novella, modern Swiss storytelling, symbolism of cat and tomcat, Gottfried Keller, Nietzsche
Vorspiel im Feuilleton
Zur Frankfurter Buchmesse 1989, wenige Wochen vor dem Mauerfall, kondolierte Frank Schirrmacher der deutschen Gegenwartsliteratur: Sie bestehe aus „Idyllen in der Wüste”. Bemerkbar mache sich das im literarischen „Versagen vor der Metropole”.1 Hinter diesem streitbaren Befund steht die Idee einer Kulturnation, die stets im Kleinen überwintern konnte, wenn es in und von der Metropole nichts Großes zu erzählen gab. Solange die durch Grenze und Mauer geteilte deutsche Nation in einer gemeinsamen Sprache und Literatur konvergierte, konnte der Roman tatsächlich ohne Hauptstadt auskommen.2 Und genau deshalb richtet Schirrmacher seinen literaturkritischen Blick auf die Literatur in der deutschsprachigen Provinz. Nur dort könnte ein Roman ohne Staat oder eine Novelle ohne Nation gedeihen.
Für die deutschsprachige Schweiz gilt das in besonderer Hinsicht. Auf die geteilte Landesgeschichte haben die modernen Erzähler mit „scharf geschnittenen Einzelteilen” geantwortet,3 mit szenischen, oft grotesken Blicken auf die verratenen Ideale und verlorenen Grundsätze der 1848er Revolution. Der Schriftsteller Gottfried Keller, den Thomas Hürlimanns 1998 uraufgeführtes Stück Das Lied der Heimat inkognito auf der Terrasse des Grandhotels Sonnenberg platziert, hoch über dem Vierwaldstättersee im Sommer seines 70. Geburtstages, liest seinem Land die Leviten, und das lautet in Hürlimanns Stück so:
„Unser Ziel war die Freiheit, Herr Ober. Ein liberaler Staat. Eine echte Demokratie. Und was ist aus unseren Idealen geworden? Eine Festhütte! Jeder Anlass zum Feiern, und ist es ein alter Schreibknecht, wird am Schopf gepackt, aus seiner Ruhe gelupft und mit verlogenem Eifer angebetet. Höhenfeuer, wohin man blickt! Lächerlich, Herr Ober, ein Festschwindel! In den Kontors lagen Raubgelder, Ferkelkrösusse und Schlauköpfe prellen das Volk um Kapital und Zinsen, und wiewohl alle tun, als würden sie die Posten von Soll und Haben hübsch verbuchen, als seien die Aktien auf Treu und Glauben erworben, ist auch dies ein Schwindel. Festschwindel und Kapitalschwindel! Ha, und erst die Politik! Was wahre Staats- und Gesellschaftsfreunde geschaffen haben, ist von Ober-, Mittel- und Unterstrebern verbogen worden, die Phantasie zerfloß in Trübseligkeit, und die Herren Volksvertreter schachern im Halbdunkel von Bierstuben um Ämtlein und Sitzungsgelder.”4
Intertextualität und Kontrafaktur: Spiegelungen von Keller in Hürlimanns Schreiben
Gottfried Keller, dessen Bücher auf Thomas Hürlimanns „Lebensbüchergestell” stehen, ist der Prototyp dieses hauptstadtfernen, grotesken und zugleich realistischen Erzählens aus der Schweiz, eines Erzählens, das die Bilder von der Schweiz mit einer „unablässigen Kritik der Bilder” verbindet:5 Die Schweiz erscheint als „Tapetenvaterland”, als Fassadennation mit ambivalenten Gründungslegenden.6 Hürlimann hat in dieser Hinsicht kritisch über sein Land geschrieben, wie Frisch und wie Dürrenmatt. Seinem berühmtesten eidgenössischen Zunftgenossen hat er mehrere Essays, ein Prosastück und einen Theaterakt gewidmet.7 Parallelen zu Gottfried Keller führen tief hinein in sein novellistisches und episches Schreiben. Die intertextuellen Keller-Bezüge in Hürlimanns Erzählsammlung Die Satellitenstadt sind bislang noch nicht hinreichend gewürdigt worden.
Intertextualität8 wird hier nicht verstanden als ein kultursemiotisches Verfahren, das einen überkodierten, hybriden Text voraussetzt, der endlos Zeichensinn produziert (Roland Barthes und Julia Kristeva) und die Instanzen Autor und Leser verabschiedet. Intertextuelles Schreiben ist für Hürlimanns Texte eine wechselseitige Spiegelung von Prätext und Text. Diese Spiegelung lässt sich als strukturalistisches Verfahren bezeichnen, das weder den Autor entmachten noch den Leser verwirren will, sondern mit der Transformation von Motiven und der Rekonfiguration von Themen die „effektive Präsenz eines Textes in einem anderen” aufscheinen lässt.9 Nicht worauf Hürlimanns Erzählungen verweisen, kommt es vordringlich an, sondern wie dies poetisch und narrativ bewerkstelligt wird: anekdotisch und grotesk. Meine These ist, dass die scheinbare Unordnung von Hürlimanns Satellitenstadt auf diesem Erzählmuster basiert. Es lässt sich als Kontrafaktur beschreiben. Dieses intertextuelle Verfahren, ursprünglich eine Umdichtung geistlicher Dichtung in weltliche (oder umgekehrt), beschreibt Änderungsrelationen von Prätext und Text: poetischer Realismus und postromantische Nachmoderne, Religion und Politik, Dorfidylle und Stadtneurose, „ernstes Kulturbild” und „freisinnige Religiosität”, wie Keller am 29.6.1875 an Friedrich Theodor Voscher schrieb.10 Hürlimanns Kontrafakturen wollen nicht besser und nicht schlechter sein als ihre Vorlage, wohl aber auf eigenwillige Weise anders.
Der „Küchen-Keller” und der „Estrich-Keller”: ‚Spiegelwelten’
Im Zentrum von Hürlimanns Keller-Rezeption steht das, was Walter Benjamin in seinem Keller-Aufsatz (1927) die „Spiegelwelt” nennt:
„Eine Spiegelwelt ist die Welt der Kellerschen Schriften ‒ freilich auch darin, daß irgend etwas in ihr von Grund auf verkehrt, rechts und links darinnen vertauscht ist. Während das Tätige, Gewichtige in ihr scheinbar unangetastet seine Ordnung wahrt, wechselt das Männliche ins Weibliche, das Weibliche ins Männliche unmerklich hinüber.”11
Genau diese Verspiegelung von Kellers Welt, in denen das helvetische Idyll durch subtile Hinweise auf Behördenwillkür und Korruption gesprengt wird,12 nimmt Thomas Hürlimann in seinem Essay Der doppelte Gottfried auf, der am 11. Juli 2019 in der Weltwoche erschienen und in dem Band Abendspaziergang mit dem Kater (2020) wiederabgedruckt ist. Hürlimann unterscheidet hier den realistischen „Küchen-Keller”, der sich an das „protestantische Kochbuch für den Kanton Zürich” der Mutter hielt und sein Schreiben als inneren Gerichtsprozess gegen sich selbst verstand, von dem romantischen „Estrich-Keller”, der „das Gewöhnliche ins Außergewöhnliche, das Sinnliche ins Übersinnliche zu erhöhen” verstand.13 Der binnenhelvetische Esprit dieser Unterscheidung beruht darauf, dass „Estrich” im Schweizer Deutsch „Dachboden” bedeutet, also nicht „Fußboden” wie in der deutschen Hochsprache. Die Spaltung der poetischen Weltsicht in einem politisch gespaltenen Land kommt also schon in der Semantik eines seiner berühmtesten Schriftsteller vor. Der 1861 vom Regierungsrat des Standes Zürich ins Amt des Ersten Stadtschreibers berufene Gottfried Keller war nicht nur ein entlaufener Romantiker, sondern auch „ein konservativer Revolutionär”,14 im Politischen wie im Religiösen.
Wappentier Katze
Das Wappentier, mit dem Thomas Hürlimann seine „Poetologie des Lokalen, der Aufmerksamkeit für den Wandel der Zeit, der Genauigkeit und der Wiederholung” entwirft,15 entstammt dem Kosmos der Kellerschen Novellen. Die vielfältigen Bezüge von Katze und Kater in Hürlimanns Werken hat Jürgen Barkhoff in einer gründlichen Studie nachgewiesen. Es ist die Katze, die mit ihrem schillernden Stromern zwischen Mensch- und Tiersein, zwischen Heimkehren und Ausschweifen in die Ferne, zwischen Hell und Dunkel, Eleganz und Trieb, Melancholie und Leidenschaft das Prinzip der Dopplung geradezu mustergültig verkörpert.16 Offensichtlich ist sie der Erzählung Spiegel, das Kätzchen entlaufen, der letzten der Seldwyler Novellen im ersten, noch in Berlin geschriebenen Teil (1856) von Kellers Novellenkranz, die wiederum spiegelbildlich der ersten Novelle des zweiten Teils (1874), Kleider machen Leute, entspricht.17
Spiegel, das Kätzchen ist die märchenhafte Geschichte von einem Kater, der sich nach dem Ableben seiner Herrin dem Seldwyler Stadthexenmeister Pineiß verdingt und in einen Pakt einwilligt: dem neuen Herren, wenn der Kater schön gemästet ist, seinen Schmer zur Verfügung zu stellen. Dem Verhängnis entwindet sich Spiegel durch listiges Fasten und eine „streng publikums- und zweckbezogene Rhetorik”.18 Am Ende ist Pineiß nicht nur betrogener Betrüger und entzauberter Hexenmeister, sondern auch Opfer einer höchst tragikomischen, von Spieglein gemeinsam mit seiner Eulenfreundin herbeigeführten Verehelichung.
Spieglein, das Kätzchen ist ein als philosophische Parabel verkleidetes Märchen über die Macht der Imagination, über die Umgarnungskraft des Erzählens und die Herstellung poetischer Gerechtigkeit. Sie spielt in einer fiktiven Stadt, in der es mit rechten und manchmal auch unrechten Dingen zugeht, in jener unheimlichen „Gemütlichkeit”, die Keller in der Einleitung zu den Seldwyler Novellen ankündigt.19 Pineiß handelt mit exotischen Gewürzen, renoviert die Turmuhr und zieht den Leuten Zähne, aber er verdreht auch Gesetze und lässt Hexen verbrennen: „er verrichtete zehntausend rechtliche Dinge am hellen Tage um mäßigen Lohn und einige unrechtliche nur in der Finsternis und aus Privatleidenschaft, oder hing auch den rechtlichen, ehe er sie aus seiner Hand entließ, schnell noch ein unrechtliches Schwänzchen an”.20 Wer will da noch unterscheiden zwischen Teufelswerk und fortschrittlichem Unternehmungsgeist?
Ganz im Kellerschen Geiste angelegt ist Thomas Hürlimanns Die Satellitenstadt (1992). Der Band porträtiert eine Stadt am Rande der Stadt, eine ironisch gebrochene Milieuaufnahme einer Pendlersiedlung neben der Metropole. Aus den zehn Novellen Kellers sind bei Hürlimann 28 kurze Geschichten geworden; die klassische Form ist mitsamt dem suburbanen Gegenstand, den sie in Ordnung zu bringen versucht, zersprengt in novellistische Humoresken und surreale Anekdoten. Die meisten erschienen in der Schweizer Weltwoche, eine in der Neuen Zürcher Zeitung, eine andere im Zürcher Tages-Anzeiger. In einer Vorbemerkung gibt ein autofiktionaler „Verfasser”, dem Hürlimann eine Harlekinmaske aufgesetzt hat, seinen Ansatz und seine Absicht preis. Nach dem für ihn unbefriedigenden Erfolg seines zweiten Stücks Stichtag,21 das einen Schweizer Fabrikanten von Kühlanlagen beim Sterben begleitet, wird der Autor mit den Ensemblemitgliedern in einen mondänen Stadtsalon geladen. Dort sitzt er allerdings alleine und bestaunt, wie sich die gastgebende Dame zur Tagesschauzeit rasant durch die Fernsehprogramme zappt: „zapp zapp zapp! schoß sie Silben und Bilder zu einem Programmsalat zusammen, der, wie ich plötzlich meinte, als unlesbare Botschaft aus der Ferne des kommenden Jahrtausends in den alten Salon hereingeflackert kam.”22
Diese Erfahrung verwilderter Medien beflügelt den Wechsel „aus der Dramaturgie des 19. in jene des 21. Jahrhunderts”, zu einem neuen Stück: „Die Story: Ein Bürger wird zum Adler.”23 Hürlimann wäre aber nicht Hürlimann, würde er nicht einen solchen künstlerischen Aufschwung mit ironischer Federung abbremsen. Er lässt seine Figuren fliegen und stürzen, straucheln und wanken, auch und gerade in ihrem Sprechen,24 und er reflektiert dieses Erzählen auf der Kippe ‒ ein Erzählen auf der Klippe ‒ durch sein Bekenntnis im Vorwort, „zugleich ein Stück und seine Trümmer [zu] fabrizieren” (S. 7). Das Storytelling der Satellitenstadt zerfasert in episodische Erzählstücke, der Erzähler haust in einem Abfallcontainer, und seine einzige Zuhörerin, Ka, seine „Liebste”, ist auf und davon. Es bleibt, von der Produktion der Trümmer, also vom Scheitern zu erzählen, dem Gegenteil des Vollendens und Fertigmachens. In seinem becketthaften Unterschlupf empfängt der „Verfasser” dann eine Weltwoche-Redakteurin mit Zipfelmütze, die ihn zum kommunizierenden Gefäß erweckt: mit dem Auftrag, für ihr Ressort „Leben heute” Kolumnen zu schreiben. Wahrheit in der Beschreibung von Selbsterlebtem und dichterische Einbildungskraft vermischen sich hier aufs innigste.
Trabantenstädte: Die Rückseite der Groteske
Die narrativen Kippfiguren und die grotesken Szenen zeigen die prätextuelle Seite des romantischen „Estrich-Kellers” in Hürlimanns Erzählen. Die realistische Seite des „Küchen-Kellers” knüpft an stadtplanerische Entwicklungen an, an Metropolenwachstum und Trabantenstädte, auf die Hürlimanns Titel Die Satellitenstadt anspielt. Aber das ist weit entfernt von einem „Urbanismus von unten, der die Stadt wiedererweckt”.33 Es geht ja nicht nur darum, dass der Idee von neuem, ökosozial gerechterem Wohnraum die Schreckbilder von urbanen Brennpunkten und Banlieus anhaften. So stellt Hürlimann der Gropiusstadt im Süden Berlins, wo die Drogengeschichte von Christiane F. beginnt, die überwiegend realistische Erzählung von der steinalten „Frau Lorentzen” an die Seite, die in einem Hochhaus wohnt, wo sich vier Mietsparteien ein Klosett teilen, und die am Ende stirbt, weil sie ihre Kohleheizung nicht mehr bezahlen kann (S. 162-165).
Aus dem Blickwinkel ‚von oben’ (also der Spiegelungen des „Estrich-Kellers”) ist vor allem die Frage interessant, wie es dazu gekommen ist, dass die Stadt so religiös verwahrlost ist. Dazu wird folgende Legende erzählt. Als ein Provinztheaterschauspieler eines Tages in seine Vaterstadt Zug zurückkehrt und das Kapuzinerkloster in der äußeren Altstadt aufsucht, hat er in der Klosterkirche eine Vision des Paters Cäsar. Der hatte früher immer im Moment der Konsekration gestockt, angerührt von der Heiligkeit der Wandlung von Brot in Leib, von Wein in Blut. Nun stemmt er den Kelch in die Höhe, und der abgehalfterte Schauspieler begreift, dass „dieser Kelch in etwa so schwer wog wie die Stadt Zug, die weiterboomte und Kräne kreisen und Bürotürme emporschießen ließ, Raketen aus Stahl, aus Chrom, aus Glas, von Musik- und Belüftungsprogrammen durchströmt, von ratternden Faxgeräten und lichternden PC-Schirmen belebt” (S. 37). Damit vergleichen lässt sich die groteske Mini-Vision, die der Erzähler hat, als er hinter dem Supermarkt einen Zirkusartisten am Pool mit Showdelphinen sieht, die ohne Zuschauer „vertrauern” (S. 107).
Mit solchen faszinierend-erschreckenden Visionen zieht ein theologischer Ernst in Hürlimanns Grotesken ein, der sie von Kellers „fragwürdigen Idyllen” unterscheidet.34 Das wirkt oft widersprüchlich, bekommt aber in der vorletzten Geschichte vom ‚Herren des Raumes’ einen triftigen Sinn. „Der Herr des Raumes” (S. 169) ist dort der Tod, den Elektrifizierung und Geriatrische Medizin aus dem öffentlichen Leben der Städte vertrieben haben ‒ aber nicht von den kriminellen Hotspots. Welche Macht ist es also, welche die Boomtown aus den Angeln gerissen hat? Der Erzähler der Satellitenstadt ist sich sicher: es ist die globale Verkabelung, und es sind die „Schirme”, mit denen die Stadt so verhängt ist, dass es sie in den Abgrund reißt. Am semantischen Wandel der „Schirm”-Metapher führt uns Thomas Hürlimann die metaphysische Unbeschirmtheit der digitalen Moderne vor Augen. Der Schirm dient nicht mehr dazu, Nässe und Hitze fernzuhalten. Als Bildschirm („Screen”) strahlt er etwas aus, um es uns nahezubringen; er vergegenwärtigt und macht sichtbar, statt zu trennen;35 mit dem Schirm verwandelt Hürlimann den ‚Borderliner der Transzendenz’ in einen „mobilen, manchmal schwebenden Weisen, der uns führt”.36
Zwischen Keller und Hürlimann steht Nietzsche, der ‒ in einer fragmentarischen Nachlassnotiz vom Herbst 188137 ‒ den Regenschirm vergisst, ein „mobiles Himmelsgewölbe en miniature”, das, wenn die „Heimat der Seele” verloren, „das einstmals göttliche Sein” nur noch „eine trostlose Umgebung” und der Mensch ein „himmelloser Engel” ist, zum „Knirps” verkümmert.38
Das hindert Hürlimann freilich nicht, das Verhängen der Städte mit Kabeln, heute Glasfaserkabeln, und das Zügeln der Handlung mit dem ‚Zapper’, den Remote-Instrumenten, als genuin dramaturgische Kategorien zu verstehen. „Das Wort Verhängnis”, so beginnt das mittlere der sieben Kapitel Die Satellitenstadt, „entstammt früheren Zeiten und kommt aus der Furcht des Kutschers vor dem Durchbrennen des Gespanns. Jagt es dem Abgrund entgegen, reißt es die Kutsche mit ‒ sie ist mit den Pferden verhängt.” (S. 73) Hürlimann erzählt wie Keller von komischen Katastrophen des (vor allem mündlichen) Erzählens;39 er ist ein „Komödiendichter”, der Verhängnisepisoden sammelt, und versteht sich demnach als „Verhängnisforscher” (S. 108, 139). Seine Aufgabe ist es, Signale zu erkennen, auch wenn er sie falsch deutet und die längste Zeit bei der Auffassung verharrt, die Satellitenstadt habe sich 1992 von der Erde gelöst und treibe steuerlos dem Saturn zu.
In der letzten Story schifft sich der Erzähler mit seiner untreuen Geliebten ein. Aber ihm steht keine „l’heure fédérale” bevor wie auf der historischen Titanic in der zweiten Geschichte, sondern ein Leben außerhalb der Städte, deren „sonderbare Abfällsel” er wie Gottfried Keller aufgelesen hat.40 Mit einer „Art Zeitweh” und „schwankend zwischen Traurigkeit und Glückseligkeit” steht das Paar am „Bug des Steamers, der seiner Abwrackung entgegendampft”, wie eine „Pyramide vor dem tropenübersäten Sternenhimmel”:41 ein glücklicheres Paar als bei Shakespeare und Keller,42 Romeo und Julia aus den Städten.
Literaturverzeichnis
Barkhoff, Jürgen: Die Katze als philosophisches und poetologisches Tier. In: Honold, Alexander und Passavant, Nicolas (Hrsg.): Thomas Hürlimann. Text + Kritik. München 2021, S. 16-24.
Bein, Thomas: Intertextualität. In: Lauer, Gerhard; Ruhrberg, Christine (Hrsg.): Lexikon Literaturwissenschaft. Hundert Grundbegriffe. Stuttgart 2011, S. 134-137.
Benjamin, Walter: Gottfried Keller. In: Ders.: Gesammelte Schriften II.1. Aufsätze, Essays, Vorträge. Hrsg. von Tiedemann, Rolf; Schweppenhäuser, Hermann. Frankfurt a.M. 1991, S. 283-295.
Böhn, Andreas: Intertextualitätsanalyse. In: Anz, Thomas (Hrsg.): Handbuch Literaturwissenschaft. Bd. 2. Stuttgart/Weimar 2007, S. 204-216.
Braun, Michael: Werk ohne Autor? Die Suche nach dem großen deutschen Roman in der Gegenwartsliteratur. In: Studia Germanica Gedanensia 42 (2020), S. 13-23.
Dukes, Hunter: Beckett’s Vessels and the Animation of Containers. In: Journal of Modern Literature 40 (2017) No. 4, S. 75-89.
Elsaesser, Thomas; Hagener, Malte: Filmtheorie. Zur Einführung. Hamburg 2007.
Genette, Gerad: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt a.M. 1983.
Häntzschel, Günther: Idylle. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 2. Hrsg. von Fricke, Harald u.a. Berlin, New York 2007, S. 122-124.
Honold, Alexander: „Die Leute von Seldwyla”. In: Amrein, Ursula (Hrsg.): Gottfried Keller Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. 2 Aufl. Stuttgart 2018, S. 53-91.
Hürlimann, Thomas: Die Satellitenstadt. Geschichten. Frankfurt a.M. 1994.
Hürlimann, Thomas: Nietzsches Regenschirm. Frankfurt a.M. 2015.
Hürlimann, Thomas: Das Lied der Heimat. Alle Stücke. Frankfurt a.M. 1998.
Hürlimann, Thomas: Abendspaziergang mit dem Kater. Frankfurt a.M. 2020.
Jean Paul: Vorschule der Ästhetik. § 73. In: Ders.: Werke, Bd. 5. Hrsg. von Norbert Miller. München 1962, S. 7-514.
Kaiser, Gerhard: Gottfried Keller. Das gedichtete Leben. Frankfurt a.M. 1981.
Keller, Gottfried: Zürcher Novellen. Frankfurt a.M. 1977.
Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. Erzählungen. In: Ders.: Sämtliche Werke und ausgewählte Briefe. Bd. 2. Hrsg. von Clemens Heselhaus. München o.J., S. 7-529.
Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. Hrsg. von Böning, Thomas (= Sämtliche Werke. Bd. 4). 2. Aufl. München 2018.
Kiesel, Helmuth: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache, Ästhetik, Dichtung im 20. Jahrhundert. München 2004.
von Matt, Beatrice: Die schweizerische Nation als poetisches Projekt: Keller bis Hürlimann. In: Holfter, Gisela; Krajenbrink, Marieke; Moxon-Browne, Edward (Hrsg.): Beziehungen und Identitäten: Österreich, Irland und die Schweiz. (Wechselwirkungen, Bd. 6). Bern u.a. 2004, S. 57-73.
von Matt, Peter: Die tintenblauen Eidgenossen. Über die literarische und politische Schweiz. München 2001.
von Matt, Peter: Die gekippten Seelen. In: Schwab, Hans-Rüdiger (Hrsg.): „… darüber ein himmelweiter Abgrund”. Zum Werk von Thomas Hürlimann. Frankfurt a.M. 2010, S. 369-375.
von Matt, Peter: Die Schweiz zwischen Ursprung und Fortschritt. Zur Seelengeschichte einer Nation. In: Ders.: Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik der Schweiz. München 2012, S. 9-93.
Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente 1880–1882. Kritische Studienausgabe Bd. 9. Hrsg. von Colli, Giorgio; Montinari, Mazzino. München 1988.
Peitsch, Helmut: Nachkriegsliteratur 1945 – 1989. Göttingen 2009.
Rauterberg, Hanno: Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne. Berlin 2013.
Schirrmacher, Frank: Idyllen in der Wüste oder Das Versagen vor der Metropole. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.1990. Wiederabdruck in: Köhler, Andrea (Hrsg.): Maulhelden und Königskinder. Zur Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Leipzig 1998, S. 15–27.
Shedletzky, Itta: „In den Geschichten leben wir weiter”. Die Wahrnehmung des ‚Jüdischen’ als fremdes Eigenes. Ein Versuch über Thomas Hürlimann. In: Schwab, Hans-Rüdiger (Hrsg.): „… darüber ein himmelweiter Abgrund”. Zum Werk von Thomas Hürlimann. Frankfurt a.M. 2010, S. 271-291.
Verweyen, Theodor und Witting, Georg: Kontrafaktur. In: Fricke, Harald (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 2. Berlin/New York 2007, S. 337-340.
Vormweg, Heinrich: Tod eines kleinen Unternehmers. In: Schwab, Hans-Rüdiger (Hrsg.): „… darüber ein himmelweiter Abgrund”. Zum Werk von Thomas Hürlimann. Frankfurt a.M. 2010, S. 116-118.
- Schirrmacher, Frank: Idyllen in der Wüste oder Das Versagen vor der Metropole. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.1990. Wiederabdruck in: Köhler, Andrea (Hrsg.): Maulhelden und Königskinder. Zur Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Leipzig 1998, S. 15‒27. ↩
- Vgl. Peitsch, Helmut: Nachkriegsliteratur 1945 – 1989. Göttingen 2009; Braun, Michael: Werk ohne Autor? Die Suche nach dem großen deutschen Roman in der Gegenwartsliteratur. In: Studia Germanica Gedanensia 42 (2020), S. 13-23. ↩
- von Matt, Beatrice: Die schweizerische Nation als poetisches Projekt: Keller bis Hürlimann. In: Holfter, Gisela; Krajenbrink, Marieke; Moxon-Browne, Edward (Hrsg.): Beziehungen und Identitäten: Österreich, Irland und die Schweiz. (Wechselwirkungen, Bd. 6). Bern u.a. 2004, S. 62. ↩
- Hürlimann, Thomas: Das Lied der Heimat. In: Ders.: Das Lied der Heimat. Alle Stücke. Frankfurt a.M. 1998, S. 456. ↩
- von Matt, Peter: Bilderkult und Bildersturm. Eine Zeitreise durch die literarische und politische Schweiz. In: Ders.: Die tintenblauen Eidgenossen. Über die literarische und politische Schweiz. München 2001, S. 71. ↩
- Diesen Spelunkenwirtshaus-Begriff entnimmt Peter von Matt Kellers Seldwyler Novelle Das verlorene Lachen. In: Keller, Gottfried: Sämtliche Werke. Bd. 2. Hrsg. von Heselhaus, Clemens. München o.J., S. 500. ↩
- Hürlimann, Thomas: Gottfried Keller. In: Ders.: Abendspaziergang mit dem Kater. Frankfurt a.M. 2020, S. 51-84. ↩
- Vgl. dazu Kiesel, Helmuth: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache, Ästhetik, Dichtung im 20. Jahrhundert. München 2004, S. 136; Verweyen, Theodor; Witting, Georg: Kontrafaktur. In: Fricke, Harald (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 2. Berlin/New York 2007, S. 337-340; Bein, Thomas: Intertextualität. In: Lauer, Gerhard und Ruhrberg, Christine (Hrsg.): Lexikon Literaturwissenschaft. Hundert Grundbegriffe. Stuttgart 2011, S. 134-137; Böhn, Andreas: Intertextualitätsanalyse. In: Anz, Thomas (Hrsg.): Handbuch Literaturwissenschaft. Bd. 2. Stuttgart/Weimar 2007, S. 204-216. ↩
- Genette, Gerad: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt a.M. 1983, S. 10. ↩
- Zit. in: Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. Hrsg. von Böning, Thomas (= Sämtliche Werke. Bd. 4). 2. Aufl. München 2018, S. 633. ↩
- Benjamin, Walter: Gottfried Keller. In: Ders.: Gesammelte Schriften II.1. Aufsätze, Essays, Vorträge. Hrsg. von Tiedemann, Rolf; Schweppenhäuser, Hermann. Frankfurt a.M. 1991, S. 291. ↩
- von Matt, Peter: Die Schweiz zwischen Ursprung und Fortschritt. Zur Seelengeschichte einer Nation. In: Ders.: Das Kalb vor der Gotthardpost. Zur Literatur und Politik der Schweiz. München 2012, S. 38f., 61f. ↩
- Hürlimann, Thomas: Der doppelte Gottfried. In: Ders.: Abendspaziergang, Anm. 7, S. 52. ↩
- Ebd., S. 59. ↩
- Barkhoff, Jürgen: Die Katze als philosophisches und poetologisches Tier. In: Thomas Hürlimann. Text+Kritik. Heft 229. Hrsg. von Honold, Alexander; von Passavant, Nicolas. München 2021, S. 21. ↩
- Vgl. ebd. und Shedletzky, Itta: „In den Geschichten leben wir weiter”. Die Wahrnehmung des ‚Jüdischen’ als fremdes Eigenes. Ein Versuch über Thomas Hürlimann. In: Schwab, Hans-Rüdiger (Hrsg.): „… darüber ein himmelweiter Abgrund”. Zum Werk von Thomas Hürlimann. Frankfurt a.M. 2010, S. 277, die auf einen „äußerst kreativen und suggestiven Königsweg” der Katzensymbolik hinweist: „Der Name Katz ist eine Abkürzung von **K**ohen **T**zedek (in der Transkription: K”tz), was ‚Priester der Gerechtigkeit’ bedeutet.” ↩
- Vgl. Kaiser, Gerhard: Gottfried Keller. Das gedichtete Leben. Frankfurt a.M. 1981, S. 283: „Glück durch Lügengeschichten” — „Glück durch Hochstapelei”. ↩
- Ebd., S. 336. ↩
- Keller, wie Anm. 6, S. 10. ↩
- Ebd., S. 218. ↩
- Vgl. Vormweg, Heinrich: Tod eines kleinen Unternehmers. In: Schwab, wie Anm. 16, S. 116-118. ↩
- Hürlimann, Thomas: Die Satellitenstadt. Geschichten. Frankfurt a.M. 1994, S. 6. Zitate hinfort mit der Sigle S und Seitenzahl). ↩
- Ebd. ↩
- „die große Sprache umgeworfen wie einen Königsmantel ‒ mag die Szene auch von Motten stieben”, schreibt Peter von Matt über Hürlimanns Stück Der letzte Gast (1990): von Matt, Peter: Die gekippten Seelen. In: Schwab, wie Anm. 16, S. 372. ↩
- Hürlimann, wie Anm. 4, S. 155. ↩
- Keller, Gottfried: Zürcher Novellen. Frankfurt a.M. 1977, S. 12. ↩
- Jean Paul: Vorschule der Ästhetik. § 73. In: Ders.: Werke, Bd. 5. Hrsg. von Miller, Norbert. München 1962, S. 258. ↩
- Günther Häntzschel: Idylle. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 2. Hrsg. von Fricke, Fricke u.a. Berlin, New York 2007, S. 124. ↩
- Kaiser, wie Anm. 17, S. 270. ↩
- Keller, wie Anm. 6, S. 9. ↩
- Barkhoff, wie Anm. 15, S. 21. ↩
- Keller, wie Anm. 6, S. 225. ↩
- Rauterberg, Hanno: Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne. Berlin 2013, S. 10. ↩
- Böning, Thomas: Kommentar. In: Keller, wie Anm. 10, S. 650. ↩
- Elsaesser, Thomas; Hagener, Malte: Filmtheorie. Zur Einführung. Hamburg 2007, S. 53-55. ↩
- Hürlimann, Thomas: Nietzsches Regenschirm. Frankfurt a.M. 2015, S. 9. ↩
- Nietzsche, Friedrich: Nachgelassene Fragmente 1880‒1882. Kritische Studienausgabe Bd. 9. Hrsg. von Colli, Giorgio; Montinari, Mazzino. München 1988, S. 587. ↩
- Hürlimann, wie Anm. 35, S. 32f. ↩
- Böning, Thomas: Kommentar. In: Keller, wie Anm. 10, S. 646, spricht vom „Schreiben über das Reden”. Honold, Alexander: „Die Leute von Seldwyla”. In: Amrein, Ursula (Hrsg.): Gottfried Keller Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. 2 Aufl. Stuttgart 2018, S. 72, analysiert die Verführungskunst des Erzählens in Spiegel, das Kätzchen als „Spiegel der fremden Blicke und Begierden”. ↩
- Keller, wie Anm. 6, S. 12. ↩
- Hürlimann, wie Anm. 4, S. 183. ↩
- Vgl. Honold, wie Anm. 36, S. 64. ↩