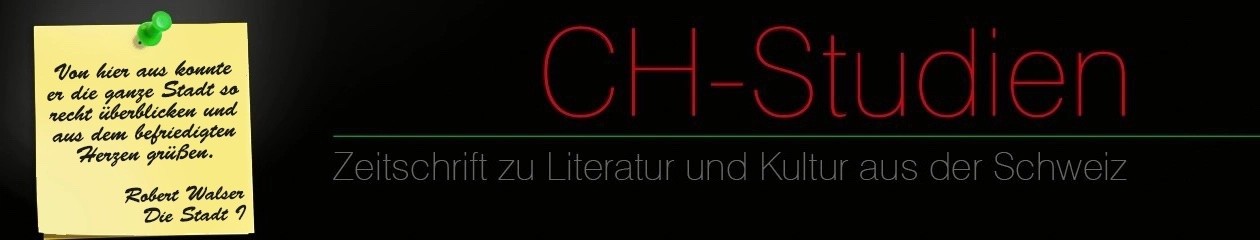Ewa Mazurkiewicz, Schlesische Universität Katowice
Der 1908 in Bern geborene Journalist, Reporter und Schriftsteller Harry Gmür ist in der Schweiz weitgehend unbekannt geblieben. Und obwohl der eine Zeit lang dem Kommunismus verschriebene linke Intellektuelle in den letzten Dekaden quasi neu entdeckt wurde – 2009 ist im Zürcher Chronos Verlag eine von den Historikern Markus Bürgi und Mario König verfasste Biographie Harry Gmürs erschienen unter dem Titel Harry Gmür. Bürger, Kommunist, Journalist. Biographie, Reportagen, politische Kommentare – galt er innerhalb des Schweizer Lesepublikums sowohl zu Lebzeiten als auch nach seinem Tod im Jahr 1979 als ein im Verborgenen gebliebener Außenseiter. Dabei war Gmürs Engagement im Bereich der Politik, der Literatur und des Journalismus seit den frühen 1930er Jahren bis in die 1970er Jahre hinein sehr intensiv und vielseitig. Erst nach der Kenntnisnahme der biographischen Zusammenhänge sowie des politischen Hintergrunds – der Situation der Schweiz und Deutschlands der 1930er Jahre, des Zweiten Weltkriegs sowie des Kalten Krieges auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs – erscheinen Gmürs Lebensentscheidungen, allerlei Brüche, Distanzierung und Isolation verständlich.
Als Großbürgersohn – sein Großvater mütterlicherseits betrieb beträchtliche Handelsgeschäfte in Singapore und Paris, sein Vater, Max Gmür, dagegen war ein angesehener Berner Professor und als Mitautor des Schweizersischen Zivilgesetzbuchs einer der bekanntesten Juristen seiner Zeit in der Schweiz – genoss Harry Gmür eine weltoffene und sorgfältige Erziehung, studierte Geschichte, Germanistik und Volkswirtschaftslehre in Bern, Paris, München und Leipzig, wo er 1933 promovierte. Die stürmischen Jahre der Weltwirtschaftskrise und des aufsteigenden Nationalsozialismus erlebte Gmür in Deutschland, was für seine Weltanschauung und seine späteren politischen Entscheidungen ausschlaggebend war: “Das Erlebnis der Weltwirtschaftskrise mit ihren Millionen Arbeitslosen, verbunden mit dem von den Monopolkapitalisten wie den preussischen Großgrundbesitzern patronisierten Aufstieg des Hitlerfaschismus ließ mir keine Wahl.”1 Seine politische Orientierung nach links sowie die 1930 geschlossene Ehe mit Genrieta Esther, der Tochter von ostjüdischen Emigranten, wurden dem jungen Gmür zu Hauptursachen, 1933 aus Deutschland in die Schweiz zurückzukehren. Neben seiner nicht standesgemässen Heirat wurde auch der 1933 erfolgende Beitritt zur “Sozialdemokratischen Partei der Schweiz” und der “Jungsozialistischen Bewegung” eine Manifestation seines Ausbruchs aus der politisch liberalen Familientradition und eine klare Distanzierung von seiner großbürgerlichen Herkunft. Auf die journalistischen Anfänge beim Feuilleton-Volontariat der “Neuen Zürcher Zeitung”, das aufgrund Gmürs politischer Überzeugung von kurzer Dauer war, folgte eine enge Zusammenarbeit mit Hans Oprecht und dessen Projekt “Plan der Arbeit”, die den jungen Intellektuellen politisch und wirtschaftstheoretisch im sozialistischen Sinn prägte. In den Jahren 1937 – 1938 war Harry Gmür Herausgeber der kulturpolitischen, antifaschistischen Wochenzeitung “ABC”, in der unter anderen Annemarie Schwarzenbach, Friedrich Glauser, Albert Ehrismann und Jakob Bührer publizierten. Als “unabhängige schweizerische Tribüne”2 berichtete “ABC” über das Cabaret Cornichon, druckte literarische Texte ab, wie etwa Friedrichs Glausers Gourrama und brachte antikoloniale und antiimperialistische Problematik zur Sprache. Für fast jede Nummer verfasste Gmür einen Text, den er jedoch nie mit seinem vollen Namen signierte. Er befasste sich u.a. mit dem Problem der fragwürdigen Neutralitätspolitik des Bundesrats, schrieb über die Lage der Arbeiterwelt sowie verfolgte die politischen Entwicklungen in Österreich vor dem nahenden Anschluß an das Dritte Reich. Wegen finanzieller Probleme, Radikalisierung des politischen Kurses nach links und einer affirmativen Position der Redaktion gegenüber der Sowjetunion erfolgte 1938 einerseits Kündigung durch mehrere Mitarbeitende, andererseits eine entschlossene Reaktion der Kantonspolizei und Bundesanwaltschaft, die in den Inhalten der Wochenzeitung eine Gefährdung der schweizerischen demokratischen Ordnung sahen. Nach 55 Ausgaben wurde “ABC” im März 1938 eingestellt.
Harry Gmür engagierte sich weiterhin politisch und journalistisch, indem er sowohl schweizerische, als auch internationale Beziehungen während des Zweiten Weltkriegs kommentierte. Eine scharfe Kritik gegenüber der eigenen SPS brachte ihm 1942 den Ausschluß aus der Partei. 1942 gründete Gmür die Partei der Arbeit und wurde zu ihrem ersten Präsidenten im Kanton Zürich. 1945 wurde er zum Chefredakteur der neu gegründeten, mit der Partei verknüpften Tageszeitung “Vorwärts”, die als “eine Zeitung für das Volk”3 gedacht wurde, wie es im Titel des Leitartikels Gmürs hieß. Als Autoren einzelner Artikel waren u.a. Leonhard Ragaz, Ludwig Hohl und Carl Albert Loosli vertreten. Mit aktuellen Themen, Aufrufen zur “Säuberung der Eidgenossenschaft von Nazis und Faschisten”4, mit Angriffen auf den Bundespräsidenten, jedoch ohne objektive Berichterstattung über die Sowjetunion und deren Kriegsverbrechen, sorgte das Blatt in der helvetischen Öffentlichkeit für eine scharfe politische Zuspitzung. In den 1940er Jahren war Gmür auch als Mitglied des Zürcher Gemeinderats sowie als Leiter des Universum-Verlags tätig. Mehrere Jahre lang und regelmäßig erfolgte die Bespitzelung und Überwachung Harry Gmürs durch den schweizerischen Staatsapparat.
In der spannungsvollen Realität des Kalten Krieges wurde Harry Gmür in der Schweiz politisch immer mehr marginalisiert, sodass sich der linke Journalist ins Private zurückzog und mit der schriftstellerischen Tätigkeit befasste. Der in den 50er Jahren geschriebene Roman unter dem Arbeitstitel La Fontana wurde 2016 als Am Stammtisch der Rebellen veröffentlicht. Eine wichtige Zäsur in Gmürs journalistischer Laufbahn erfolgte 1958, als er eine langjährige Zusammenarbeit als Reisereporter mit der in Ostberlin erscheinenden “Weltbühne” aufnahm, die in der Weimarer Republik als wichtiges Forum der bürgerlichen Linken unter der Leitung von Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky galt. Zwischen 1958 und dem Ende der 1970er Jahre sind in der Zeitschrift insgesamt 310 Artikel von Harry Gmür erschienen. Keinen seiner Texte signierte der Autor mit seinem wahren Namen, stattdessen verwendete er Pseudonyme, vorwiegend Stefan Miller oder Gaston Renard. Neben seinen Reportagen für die DDR-Zeitschrift publizierte Gmür in Ostdeutschland fünf erfolgreiche Reisebücher, etwa über Guinea, Nigeria, Griechenland und Spanien. Sowohl seine Buchpublikationen als auch Zeitungsartikel waren für Leser bestimmt, die weniger an touristischem Blick als an einer politisch-sozial profilierten Betrachtung interessiert waren. Gmürs besonderes Interesse galt den afrikanischen Ländern, er unternahm mehrere Reisen nach Afrika und verfasste dazu über hundert Reportagen für die “Weltbühne”.
In den in der Zeit der Dekolonisation entstandenen Artikeln werden neben der Betonung von kultureller Vielfalt Afrikas die Befreiungskämpfe der afrikanischen Völker thematisiert und die Zusammenhänge der grausamen Kolonialherrschaft erklärt. Während Gmürs frühere Reportagen aus Afrika zum Teil noch den kolonialen Blick beinhalteten, gewann seine Rhetorik mit der Zeit an postkolonial geprägter Reflexion, sodass die “Weltbühne”-Texte sich wesentlich von der parallel in der “Neuen Zürcher Zeitung” vermittelten (post)kolonialen Narrative unterscheiden, etwa in dem Bericht aus Guinea von Edmund C. Schwarzenbach 1959,5 der eine typisch eurozentrische Perspektive des „weißen Blicks“ präsentiert. Auf seine Afrikareisen hatte sich Harry Gmür gründlich durch Fachlektüre vorbereitet, so dass seine Reportagen durch historische Hintergründe vertieft wurden und in vielen Fällen ein komplexes Bild lieferten. Zum Hauptanliegen wird in den Afrika-Reportagen vor allem jedoch die aktuelle Situation in den ehemaligen Kolonialländern; der Reporter bemüht sich an vielen Stellen, die Perspektive des Betrachteten zu übernehmen und dem Leser bewusst zu machen, dass das in Europa herrschende Bild von Afrika eine imaginierte, durch den weißen Kolonisator geschaffene, dessen Überlegenheit gegenüber dem Kolonisierten voraussetzende Konstruktion ist, ganz im Sinne der von Edward Said 1978 entwickelten Konzeption des Orientalismus als eines hegemonialen Macht- und Herrschaftsverhältnisses. 6 Der Autor bemüht sich, einige stereotype Bilder des afrikanischen Kontinents zu entlarven und zu widerlegen. An vielen Stellen der vorwiegend in den 1960er Jahren geschriebenen Reisereportagen aus Afrika scheint sich Gmürs Narrativ den postkolonialen Theorien zu nähern, die zum Teil erst im Laufe der 1960er und 1970er Jahre entwickelt wurden.
In Gmürs Texten über Nigeria und Guinea lassen sich jedoch neben nüchternen und ausgewogenen Beobachtungen einige Spuren seines ideologisierten, sozialistisch geprägten Denkens aufweisen: „Gmür suchte nach einem entstehenden afrikanischen Sozialismus und meinte diesen hier zu finden, bei allen auch von ihm registrierten Unvollkommenheiten.”7 Sein Verständnis von Wirtschaft und Politik ließ ihn an manchen Repressionen und Unzulänglichkeiten vor Ort vorbeizusehen, soweit sie “unter sozialistischen Vorzeichen standen”8.
Der Text Im Königspalast entstand 1966 und wurde in der Zeitschrift “Weltbühne” sowie in dem Buch Nigeria zwischen Wüste und LaguneIm Königspalast veröffentlicht. In beiden Publikationen steht der Name Stefan Miller als Autor. In Gmürs Reportagenserie aus Nigeria werden die Städte, wie Lagos und Benin einerseits als alte Handels- und Kulturzentren, andererseits vor dem Hintergrund deren kolonialen Geschichte und der aktuellen politischen Spannungen dargestellt. In seinem aus derselben Zeit stammenden Artikel Lagos – Stadt in der Lagune verweist der Autor auf die anhaltenden britischen Dominanzstrukturen und benutzt dafür das neu geprägte, 1956 von Jean Paul Sartre in den postkolonialen Diskurs eingeführte, 1963 vom ersten Ministerpräsidenten Ghanas, Kwame Nkrumah, aufgenommene Wort “Neokolonialismus”9. Während in den über Nigeria verfassten Texten die kritische postkoloniale Perspektive dominiert, zeigt sich Gmür optimistisch gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und kann noch nicht die nahenden blutigen Konflikte voraussehen, von denen der Leser später etwa in den Reportagen Ryszard Kapuścińskis10 erfahren konnte.
Die Reportage Im Königspalast thematisiert eine Begegnung des Journalisten mit dem Oba von Benin, Akenzua II., dem höchsten politischen und rituellen Oberhaupt, dem Erben “eines uralten glanzvollen Königsthrons”11. Auf die respektvolle, feierliche Erwartung der Majestät in ihren “königlichen Gemächern“12 folgt ein direktes, nahezu informelles Gespräch: ”Er hieß mich nach einem ganz gewöhnlichen Händedruck sitzen und fragte, was ich trinken möchte, ein Bier oder einen Orangensaft.”13 Auch hier präsentiert der Autor seine kritische postkoloniale Perspektive und vermeidet die eurozentrische Haltung, die sein nigerianischer Gesprächspartner bei ihm vorauszusetzen scheint, indem er selbst die europäische Sichtweise annimmt: ”Wir stehen hier in Afrika um viele Jahrhunderte hinter Europa zurück, bemerkte Akenzua […]. Ich erwiderte, dies gelte doch zur Hauptsache nur für den Bereich der industriellen Technik und der modernen Wissenschaften, wo in einigen Jahrzehnten angestrengter Arbeit das meiste nachgeholt werden könne, nicht für andere Gebiete menschlichen Daseins und menschlicher Entwicklung.”14 Das Gespräch der beiden Männer konzentriert sich auf die politischen und geschichtlichen Zusammenhänge der kolonialen wie postkolonialen Zeit von Nigeria sowie auf dessen kulturellen Reichtum. Harry Gmür nimmt in seiner Reportage das Problem der in der Kolonialzeit als Beutekunst aus Benin geraubten Kunstwerke vorweg und somit auch einen Diskurs auf, der seinen Höhepunkt erst im 21. Jh. erlebt: ”Der Oba empfahl mir natürlich den Besuch des nahen Kunstmuseums. >Viele unserer Kunstschätze befinden sich ja heute im Ausland, in London, auch in Berlin <, klagte er, > aber was wir behalten haben, ist wohl immer noch sehr sehenswert.<”15
Vor dem Hintergrund der aktuellen regen Diskussion über die Zurückführung der kolonialen Raubkunst zu ihren ursprünglichen Besitzern, angesichts des klaren, zur endgültigen Auseinandersetzung mit dem postkolonialen Erbe aufrufenden Diskurses in Europa lassen sich die Afrika-Reportagen Harry Gmürs, abgesehen von den an manchen Stellen durch sozialistisch geprägte Denkmuster fragwürdigen Thesen und Diagnosen, als wichtige Pionierarbeit im Bereich der deutschsprachigen postkolonialen Literatur betrachten.
- Harry Gmür, zitiert nach: Markus Brügi, Mario König: Harry Gmür. Bürger, Kommunist, Journalist. Biographie, Reportagen, pilitische Kommentare. Chronos Verlag, Zürich 2009, S. 22. ↩
- Ebd, S. 40. ↩
- Ebd, S. 78. ↩
- Ebd., 82. ↩
- Vgl. Ebd., S. 118. ↩
- Vgl. Edward Said: Orientalismus. Ullstein: Frankfurt/Main 1981. ↩
- Markus Bürgi, Mario König: Harry Gmür, S. 122. ↩
- Ebd., S. 123. ↩
- Vgl. Dirk Gottsche, Axel Dunker, Gabriele Dürbeck (Hg.) Handbuch Postkolonialismus und Literatur. J.B. Metzler: Stuttgart 2017, S. 194. ↩
- Vgl. Ryszard Kapuściński: Afrikanisches Fieber. Erfahrungen aus vierzig Jahren. Piper 2016. ↩
- Harry Gmür (Stefan Miller): Im Königspalast. In: Reportagen von links. Vier Jahrzehnte Kampf gegen Faschismus und Kolonialismus. Mit einem Vorwort von Jean Ziegler. Europaverlag: Zürich 2020, S. 264. ↩
- Ebd., S. 265. ↩
- Ebd., 267. ↩
- Ebd., S. 266. ↩
- Ebd., S. 270. ↩