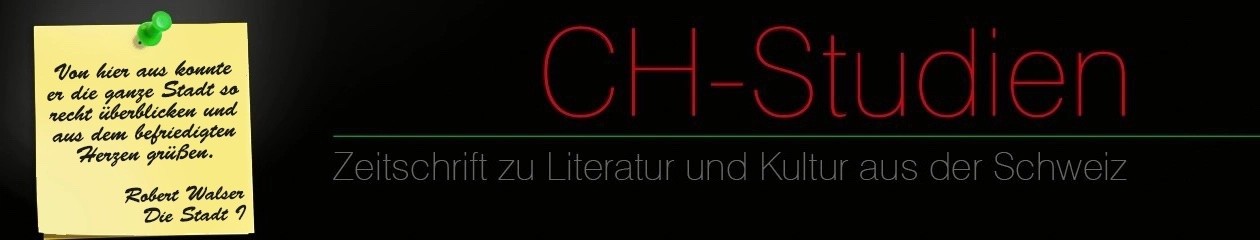Joanna Nowotny, Schweizerisches Literaturarchiv der Schweizerischen Nationalbibliothek, Bern
Der Aufsatz behandelt die Funktion der vielen Tierfiguren, -vergleiche und -bilder in Adelheid Duvanels Text- und Bildwerk. Drei Unterkapitel beleuchten drei verschiedene Facetten von Duvanels Schreiben von und mit Tieren: Zuerst stehen die Fabel-Variationen zur Debatte, die Duvanel in den frühen Sechzigern publizierte. In ihnen macht sie die fundamentale Fremdheit zwischen Lebewesen zum Thema, auch und gerade dann, wenn Tiere auf einer formalen und einer inhaltlichen Ebene vermenschlicht werden. In einem zweiten Teil werden die noch kaum bekannten Tierkolumnen näher beleuchtet, die Duvanel in den Siebzigern für die Basler Zeitung „Doppelstab” verfasste. Anhand von Haustieren entwickelt Duvanel hier positive Visionen eines Umgangs mit Alterität — ironischerweise werden die ‚schrägen Vögel’ dieser Texte menschlicher behandelt als Duvanels menschliche Figuren, die nicht der Norm entsprechen. Im dritten Unterkapitel wird analysiert, wie Duvanel auf der Bild- und Vergleichsebene Menschen, Tiere und Naturkräfte vermengt, mit zentralen Weiterungen für die Erzähl- und Darstellungsperspektive sowie für den Handlungsspielraum der Figuren im Werk. Aus der Auflösung von Grenzen – zwischen Lebewesen, Lebewesen und Objekten, Menschen und Tieren, Naturkräften und Tieren – resultiert die ontologische Verunsicherung, durch die Duvanels Figuren und Texte geprägt sind.
Schlüsselwörter: Adelheid Duvanel, Animal Turn, Kulturwissenschaften, Anthropomorphismus
„Mein Freund ist der Fuchs”. Adelheid Duvanel’s Animal Stories
This article deals with the many animals that appear as characters or in metaphors in Adelheid Duvanel’s textual and pictorial work. Three sub-chapters illuminate three different facets of Duvanel’s writing about and with animals: Firstly, the ‚fables’ that Duvanel published in the early sixties are analysed. In them, she addresses the fundamental estrangement between living beings, even and especially when animals are humanized on a formal level and in the story itself. In a second sub-chapter, the little-known animal columns that Duvanel wrote for the Basel newspaper „Doppelstab” in the 1970s are examined in more detail. Here, Duvanel uses pets to develop positive visions of how to deal with alterity and difference — ironically, the birds in these texts are treated more humanely than Duvanel’s human characters who do not conform to the norm. The third sub-chapter analyses how Duvanel mixes humans, animals and natural forces in her comparisons and metaphors, with important implications for the narrative and representational perspective as well as for the characters’ scope for action in the work. The dissolution of boundaries – between living beings, living beings and objects, humans and animals, natural forces and animals – results in the ontological uncertainty that characterises Duvanel’s characters and texts.
Keywords: Adelheid Duvanel, Animal Turn, Cultural Studies, Anthropomorphism
„Wer sagt mir, dass das fremde Gewächs in meinem Bauch wirklich ein Kind ist? Ist es ein Mensch mit zwei Augen, einer Nase, einem Mund? Ist es nicht ein Ungeheuer, blau getupft, mit einem Schnabel?”1 Mensch, „Gewächs” oder Monstrum mit Vogelzügen – diese verstörende Frage stellt sich die schwangere Erzählerin in Adelheid Duvanels (1936-1996) Kurzerzählung Die Ordnung (1983). Seit Duvanels Sämtliche Erzählungen 2021 unter dem Titel Fern von hier (Limmat) publiziert wurden, erhält ihre prägnante, oftmals verstörende Prosa im Feuilleton2 und in der Literaturwissenschaft3 erhöhte Aufmerksamkeit. Die Basler Autorin, die zu Lebzeiten so einflussreiche Fürsprecher*innen und Unterstützer*innen wie Beatrice von Matt und Peter von Matt, Otto F. Walter oder Maja Beutler hatte, entwickelte einen ganz eigenen literarischen Kosmos, durch den verschrobene, widerständige Figuren wandeln. Sie schuf unter schwierigsten Lebensumständen, zu denen eine Abhängigkeitsbeziehung zu einem oft brutalen und tyrannischen Mann, das Drogen- und spätere HIV-Elend der Tochter, eigene langjährige Aufenthalte in der Psychiatrie sowie finanzielle Notlagen gehören, ein faszinierendes Werk aus Kurzerzählungen, Kolumnen, Bildern und Briefen.4 Und in Adelheid Duvanels Werk wimmelt es nur so von Tieren: Sie huschen durch Erzählungen und Zeitungstexte, sie interagieren mit oder handeln wie Menschen, sie werden über Vergleiche und Metaphern aufgerufen und zieren die stark farbigen Bilder der doppelbegabten Künstlerin.
Im vorliegenden Aufsatz möchte ich unterschiedlichen Tiertexten und verschiedenen Funktionen von Tierfiguren und -bildern in Duvanels Werk nachspüren: von den Fabel-Variationen der 1960er, den frühesten publizierten Texten mit Tierfiguren, zu den noch kaum bekannten Tierkolumnen der 1970er Jahre und zu den Tierbildern und -vergleichen, die über Duvanels ganze Schaffenszeit hinweg präsent sind. Während in den ersten zwei Unterkapiteln in der Terminologie Roland Borgards sogenannte diegetische Tiere zur Debatte stehen, also Tiere, die auf der Ebene des Erzählten existieren und handeln, fragt das dritte Unterkapitel auch nach non-diegetischen oder semiotischen Tieren, „die in Texten ausschließlich als Zeichen, als Träger von Bedeutungen erscheinen”5 – und die doch einen entscheidenden Einfluss auf das menschliche Figurenpersonal haben. Duvanels facettenreiche Tiermotivik und -thematik ist eng verwoben mit rhetorischen und ästhetischen Konzepten und Strategien, die ihre Texte und, wie ebenfalls zu zeigen, ihr im Nachlass erhaltenes Bildwerk bis in den Kern prägen, und der vorliegende Aufsatz soll erste Ansätze zu einer Deutung dieser Aspekte im Kontext des Gesamtwerks und seiner Entwicklung liefern.
I. Diegetische Tiere: Vermenschlichung und Fremdheit
Durch Duvanels erste, in den Balser Nachrichten publizierte Erzählungen wuseln zahlreiche Tiere. Meistens erscheinen sie am Rand des Erzählten, in Namen – ein „Anstaltskomplex trägt den friedlichen Namen ‚Rehweid'”6 –, in Vergleichen oder als Teil einer Szenerie, zu der beispielsweise „jodelnde Vögel” gehören (597). Zu dieser Zeit experimentiert Duvanel aber auch mit einer Form, in der Tiere zu Hauptfiguren werden, als diegetische Tiere die Handlung antreiben: Sie verfasst die beiden Fabel-Variationen Ein Hahn namens Eugen (605 f., 6.8.1961) und Was die Schnecke erlebte (609, 11.3.1962).7 Fabeln, eine in der Literaturgeschichte höchst produktive Gattung, sind belehrende Erzählungen, in denen mit menschlichen und verschiedenen Arten oftmals fix zugeordneten Attributen versehene Tierfiguren auftreten.8 Der Hahn gilt dabei sprichwörtlich als stereotyp männliches und eitles Tier, ein Attribut, das in der ersten Fabel-Variation gattungstypisch umgesetzt wird: Der Hahn Eugen hält seinen Kamm für eine Krone und will wie ein König behandelt werden, was seine Artgenossen nur zum Lachen finden. So lernt er „die menschliche Sprache” und verkündet: „Ich bin ein König!”, und die Menschen, schwer beeindruckt, rufen ihn direkt zum Gott aus (605). Als er ein Huhn begehrt und „Vater” wird, verstehen die Menschen dies als Zeichen, dass Eugen „ein wunderbarer Gott” ist, „er fühlt sich nicht zu erhaben, um ein niedriges Huhn zu lieben.” Doch dann naht seine „Todesstunde”: Eugen, der sich nun selber für einen Gott hält, ist betroffen, die Menschen aber lassen sich nicht von ihrem Glauben abbringen. Dies macht den richtigen Gott so zornig, dass er es dem Tod verbietet, „Eugen heimzusuchen”. Der nun ewig lebende Hahn „verleidet” (606) jedoch den Menschen und versinkt in der Bedeutungslosigkeit.
Das Erzählte behandelt den Kipppunkt zwischen dem Tierischen und dem Menschlichen. Wie in Franz Kafkas Bericht für eine Akademie (1917), der Geschichte der versuchten ‚Menschwerdung’ des Affen Rotpeter, ist es das Beherrschen der menschlichen Sprache, das Eugen über seine Artgenossen erhebt.9 Anders als der Kafka-Text10 spielt Ein Hahn namens Eugen allerdings mit religiösen Motiven und Themen: Die Dyade Mensch-Tier wird zu einer Triade Mensch-Tier-Gott erweitert. Dass Gott in dieser Kurzerzählung auftritt, steht in Opposition zum klassischen Fabelerzählen; dieses speist sich seit Äsop typischerweise gerade daraus, dass zwar ein nicht der alltäglichen Realität entsprechender Kosmos konstruiert wird, dieser aber nicht in Konkurrenz oder Koexistenz mit etablierten Religionen steht. Über die religiösen Motive wird Eugens Geschichte auch lesbar als Jesus-Parodie, denn die Menschen interpretieren noch seinen nahenden Tod als Zeichen, dass er sich „nicht zu erhaben” fühle, „den Tod zu erleiden wie wir” (605). Ein Hahn namens Eugen entwirft so einen Reigen von absurden Missverständnissen und Fehldeutungen: Eugen hält seinen Kamm für eine Krone; die Menschen halten ihn für Gott; darauf beginnt er selbst sich für Gott zu halten; und Gott macht ihn aus ‚Rache’ unsterblich. Gottes Handeln ist der Gipfel der Ironie – im Bestreben, das Narrativ des göttlichen, aber sterblichen Hahns zu durchbrechen, verleiht Gott Eugen eine wahrhaft ‚göttliche’ Eigenschaft, die der Unsterblichkeit. Genau dann jedoch, als Eugen wirklich über alle anderen Lebewesen erhoben wird, finden die Menschen ihn langweilig.
Was die Schnecke erlebte erzählt ebenfalls von Kommunikationsschwierigkeiten: Eine Schnecke verlässt „ihr schützendes Haus”, „da es ihr zu eng und dunkel erschien” (609). Sie befreundet sich mit einem Chamäleon, und die beiden begegnen dem Kind „Sutja”, mit dem sie viel „plaudern”. Doch nachdem das Chamäleon darüber lacht, dass Sutja für ihr „verstorbenes Meerschweinchen ein Vaterunser” betet, damit es auch ungetauft „in den Himmel […] gelangen” kann, schlägt das Mädchen es mit einem Stein tot: „Nun begann die Schnecke gar jämmerlich zu schreien und strebte, so schnell sie es vermochte, von diesem Ort des Grauens fort, um ihr Haus zu suchen und wieder gebückt im Dunkeln zu wohnen” (ebd.). Duvanel verwendet in dieser Erzählung das typische Fabelschema aus Auszug, Lektion und Rückkehr, variiert es jedoch zu Auszug, Lektion und misslingender Rückkehr. Die Lektion, das völlige Missverstehen zwischen Mensch und Tier und seine brutalen Resultate, hat einen solch grausamen Charakter, dass die Rückkehr für die Schnecke, ein eigentlich immer sprichwörtlich ‚behaustes’ Tier, nicht möglich ist: „Sie fand” ihr Haus „nicht mehr” (ebd.).
In beiden frühen Fabel-Variationen behandelt Duvanel an Tieren die Thematik der Kommunikation (oder ihres Scheiterns) im Zusammenhang mit einem religiösen Denken. In der fast zeitgleich entstandenen und ebenfalls in den Basler Nachrichten erschienenen Erzählung Im Schatten des Irrenhauses (3.7.1960) ist die Rede davon, dass vielleicht auch „der Vogel und der Fisch, das Seepferdchen und das Meerschweinchen” einer „Weltanschauung huldigen”, die „allem Tun und Lassen, Sein und Werden übersinnliche und gar ewige Bedeutung” zumisst; die Tiere haben aber wahrscheinlich „uns”, also die Menschen, als „unverständliche und daher minderwertige Ware nicht in ihren Heilsplan mit einbezogen” (587). Die beiden Fabel-Variationen zeigen, dass eine andere Spezies auch dann „unverständlich[]” bleibt, wenn sie in den „Heilsplan” mit einbezogen wird, oder zugespitzt: gerade die Projektion menschlicher religiöser Konzepte auf Tiere führt zum Unverständnis, das in Was die Schnecke erlebte äusserst brutale Konsequenzen hat. Sutja vermenschlicht ihr verstorbenes Meerschweinchen so sehr, dass sie sogar ein christliches Jenseits für es in Anspruch nimmt, wobei die Tendenz einer Erhebung von Haustieren über alle anderen Tiere, ihrer Akzeptanz als ‚menschenähnlich’, durchaus der historischen Realität entspricht.11 Gerade die ‚Gleichstellung’ von (Haus-)Tier und Mensch hat brutale Konsequenzen, durch sie schlägt die Kommunikation zwischen den Spezies in Gewalt um – dies ist die absurde Pointe der Erzählung. Auf der Ebene des Inhalts und der Form wird so in Duvanels frühen Fabel-Variationen vorgeführt, dass ‚Vermenschlichung’ keinen Weg zu einem Verständnis zwischen Mensch und Tier ebnet, ganz im Gegenteil — gerade in den Fabeln mit ihren so vermenschlichten Tieren zeigt sich die fundamentale Fremdheit der Spezies. In Duvanels Texten tritt somit nicht ein, was Conrad in Bezug auf die Gegenwartsliteratur, -kunst und die Philosophie als utopisches Projekt benennt: „[I]t is in recognizing the capacity for mutual unknowing – for stepping into an area […] in which it is no longer clear what belongs to human or nonhuman, self or other – that a groundwork for relationality can emerge.”12 Mensch und Tier missverstehen einander, solange sie nur ihre jeweiligen ‚Weltanschauungen’ und ‚Heilspläne’ auf den anderen projizieren, anstatt sich seiner Fremdheit zu öffnen und damit wahre Begegnungen zu ermöglichen.
Direkte Fabel-Variationen verfasste Duvanel später nicht mehr; dass sie die Form nicht befriedigte, ist vielleicht auch daraus abzulesen, dass sie Ein Hahn namens Eugen und Was die Schnecke erlebte nicht in die späteren Erzählsammlungen mit aufnahm. Das Thema der Fremdheit zwischen Figuren und des (oftmals scheiternden) Versuchs zu kommunizieren prägt Duvanels Werk jedoch weiter. Tiere bleiben hierbei zentral, und zwar als Gegenpol zu einer menschlichen Welt, in der sich die Protagonist*innen oftmals nicht heimisch fühlen. Besonders Kinder flüchten sich in ihrer Fantasie in eine Tierwelt, wie Hannes aus Die goldene Naht (1976), der sich vorstellt, „die Wohnung sei ein Blumenkelch, die Mutter eine Wespe und er ein Bienchen” und sich unter diesem „süßen, weichen Bilderbuchhimmel” geborgen fühlt (23).13 Und „Luzia mit vierzehn Jahren” (1976) liest lieber in einem „Tierbuch”, anstatt die neue Freundin ihres Vaters zu begrüssen; „[f]ür Tiere interessierte sie sich” (30).
Beispielhaft kommen Entfremdungs- und Fluchtmotiv und Tierthematik in den 1980er Jahren in der Märchenvariation14 Der Fuchs (1985) zusammen. In einer „Siedlung am Waldrand” (198) wohnt ein Mädchen, das von seiner Mutter „nie berührt, nie [ge]küsst” wird (198). Ein junger Mann erscheint – das Mädchen empfängt ihn zuerst mit Ablehnung: „Du bist ein Fremder, […] mit Fremden rede ich nicht; sie verstehen mich nicht. Meine Wirklichkeit ist nicht ihre Wirklichkeit.” (198 f.) Er entführt das Mädchen in den Wald, wo die Bäume „ihre dünnen Äste” „[w]ie Fühler” nach ihnen ausstrecken, und da sie „den Ausgang nicht finden”, bleiben sie dort (199). Ein „Fuchs trägt ihnen die prächtigsten Hühner herbei. Das Mädchen spricht bald die Sprache des Fuchses, die der junge Mann nicht erlernt”: „Nur mit dem Fuchs kann ich noch sprechen, denn seine Sprache ist die Sprache meines innersten Wesens. Mein Freund ist der Fuchs.” (199 f.) Ein bekanntes Märchenmotiv, das durch zahlreiche Disney-Zeichentrickfilme popularisiert wurde, wird hier ins Extrem getrieben, das des Kommunizierens von ‚Märchenprinzessinnen’ mit Tieren. Das Mädchen erinnert an Dornröschen; seit einem Traum(a) – sie „träumt eines Nachts, schwarzgekleidete Frauen schlügen sie an ein Kreuz, das neben ihrem Bett auf dem Boden liegt; sie erwacht schreiend” – wurde sie „nie mehr ganz wach” und nahm „ihre Umgebung nicht mehr wahr” (198). Der junge Mann oder Märchenprinz küsst sie nicht wach, er bleibt „ein Fremder”, fremder als das Tier, und lässt sie zuletzt im Wald in ihrem geheimnisvollen Einverständnis mit dem Fuchs zurück.
II. Vogelviten: Die Lebensgeschichten von Haustieren in Duvanels Tierkolumnen
Duvanels Text Finderli (28. Februar 1977) beginnt mit einer selbstreflexiven Volte. Die Erzählstimme denkt über das Vergleichen nach, besonders über den Vergleich Mensch-Tier, der ja konstitutiv ist für die Gattung der Fabeln: „Wollte man unsere Vögel mit Blumen vergleichen (schliesslich vergleicht man ja Menschen mit Tieren…), wäre das Grünfinkenweibchen ‚Finderli’ ein Veilchen.”15 Finderli stammt aus einem ganz anderen Tierformat, das Duvanel in den 1970ern beschäftigte: Zwischen 1974 und 1979 schrieb sie für die Basler Gratiszeitung Doppelstab, bei der ihr Bruder als Redaktor arbeitete, unter dem Decknamen „Martina” Beiträge für die Kolumne Unsere Tiergeschichte, in der „Haustiere zu Helden werden”.16 Im Zentrum der vorliegenden Erörterungen steht ein Zyklus aus Vogel-Texten, wobei Hausvögel zu Duvanels typischen Kolumnen-Sujets gehören.17 Sie entwirft in der Kolumne ein rhizomatisch strukturiertes Vogeluniversum, dem ein Netz aus Anspielungen unterlegt ist; die aufmerksame Leserin wird in nebenbei erwähnten Vögeln die Protagonist*innen aus anderen Texten erkennen können.18 Es ist die serielle Struktur der Kolumnen, die solche Querverbindungen ermöglicht – sie hebt sich ab gegen die üblicherweise einzeln für sich stehenden Erzählungen.
Zwei Texte erzählen von Vögeln, deren Leben unter schwierigen Umständen beginnt: Das erwähnte Finderli (28. Februar 1977)19 und Der finstere Ruby (14. März 1977).20 Am Anfang des Lebens von „Finderli” steht Gewalt, möglicherweise ausgeübt durch Artgenossen, daraufhin aber ganz sicher durch Männer: „Als winziges, noch fast ungefiedertes Etwas fiel es aus dem Nest (oder wurde hinausgestossen); sein Pech war, dass die Vogeleltern seine Wiege im Garten eines Restaurants aufgestellt hatten; so geriet es in die Finger von rohen, angetrunkenen Männern, die es unter Gelächter in eine Flasche stecken wollten.” Diese Schilderung erinnert mit ihrer vergeschlechtlichten Dynamik an eine Vergewaltigung, eine Assoziation, die dadurch verstärkt wird, dass „Finderli” mit allerlei stereotyp weiblichen Eigenschaften ausgestattet wird, so die Bescheidenheit, den „Charme, der den Liebhaber des Unauffälligen entzückt”, und der den Vogel „[a]ltjüngferlich[]” wirken lässt. Die „zehnjährige Tochter” von Martina rettet „Finderli” aus der misslichen Lage, und Mutter und Tochter nehmen den Findling in Folge überall hin mit: „Lud man uns irgendwo ein, sagten wir: ‚Wir kommen aber mit Vogel!’ […] Wer uns im Restaurant, in einer Galerie oder im Theater mit Korb und Glas auftauchen sah, sagte zu Recht: ‚Jetzt kommen die Leute mit dem Vogel'”, erzählt Duvanel mit dem für die Kolumnen typischen Sprachwitz. Dabei nimmt sie offensichtlich die Redewendung ‚einen Vogel haben’ beim Wort.21
Der finstere Ruby wiederum ist ein Vogel, der nach dem Pianisten „Arthur Rubinstein” benannt ist – Musikreferenzen sind typisch für die Tierkolumnen, die den Vogelgesang beispielsweise in durchaus erwartbarer Manier mit dem Klavierspiel des Ehemanns in Verbindung bringen.22 Ruby, „ein typischer‚Verschupfter'”, hockte auf einem Markt in Italien in „einem zu engen Käfig vielleicht tagelang in der brütenden Sonne” und litt „Hunger und Durst”, dann wurde er „in einer kleinen Schachtel” in die Schweiz transportiert, befreite sich im Auto, flatterte umher und erlitt einen „Schock”; er kam „von Platz zu Platz; niemand befreundete sich mit ihm, und mit niemandem konnte er sich anfreunden.” Kurzum: Ruby erfuhr „von den Menschen nur Schlechtes”, bis er in „Martinas” Familie kommt. Dort demonstriert er Anzeichen einer tierischen Essstörung: „er war so sehr ‚milieugeschädigt’, dass er in unserer Gegenwart weder frass noch trank. Wenn wir ihn bei seinen Mahlzeiten ‚ertappten’, wandte er sich ab und tat so, als habe er überhaupt kein Interesse daran, seinem Körper Speis und Trank zuzuführen. ‚Wie ein Heiliger’, sagte unsere Tochter. ‚Ein Kranker, ein Asozialer’, berichtigten wir; nicht verurteilend, sondern liebevoll. Wir hatten uns vorgenommen, Ruby zu heilen.”
Zwei Erklärungsansätze für ein nicht der Norm entsprechendes Verhalten werden gegeneinander ausgespielt: ein alter, der es als Zeichen der Auserwähltheit, des Heiligen liest; und ein moderner, der es auf psychische und soziale Störungen bezieht und „heilen” will. Besonders der Begriff „milieugeschädigt” wirkt in seiner Übertragung auf ein Tier einerseits leicht humoristisch und zeugt andererseits von Duvanels eigenen Erfahrungen in der Psychiatrie und mit Randständigen: In der Psychologie und Soziologie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte er Konjunktur und bezeichnete seelische Schäden, die aufgrund ungünstiger Einflüsse des sozialen oder kulturellen Umfelds zustande kommen. „Martina” erzählt hier in einer Tiergeschichte von Traumata, von „Depressionen” und Ansätzen der Besserung: „Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, einen Kontakt zwischen uns und dem schwierigen Tier herzustellen. Rubys Depressionen scheinen fast ganz verschwunden; er betrachtet uns kritisch, aber nicht mehr hasserfüllt.” Wenn der Titel Der finstere Ruby ans Genre der Kriminalliteratur mit den eingängigen Spitznamen der ihrerseits oftmals ‚milieugeschädigten’ Gangster denken lässt, so wird diese Erwartung durch die tragische Geschichte sofort konterkariert – für den ‚finsteren’ Ruby empfinden auch die Lesenden sofort Empathie.
In Finderli und in Der finstere Ruby erzählt „Martina” die Lebensgeschichte von Geschädigten, die einen Raum finden, in dem sie existieren und Vertrauen zu Menschen fassen können, einen Raum, in dem sie angenommen werden. Auch Duvanels menschliche Figuren sind häufig ‚schräge Vögel’, sie sind geprägt durch die Differenz zu einer Norm, durch ihr Aussenseitertum – im Falle der Tierfiguren ist diese Alterität in die Differenz zwischen den Spezies hinübergespielt, und doch werden die Vögel besser behandelt als viele ihrer Menschenfiguren durch andere Menschen und die sie umgebende Gesellschaft. Wenn „Martinas” Familie den Vögeln mit ihren Macken und Traumata in den Kolumnen derart menschlich begegnet, so werden vom ‚Normalen’ abweichende Menschen umgekehrt schon in der erwähnten, der frühesten publizierten Erzählung Duvanels, Im Schatten des Irrenhauses, wie Tiere behandelt: Geistig kranke Menschen werden in einem „Gehege” (588) gehalten, in einer Abteilung in der psychiatrischen Klinik, die auch „Zoologischer Garten” genannt wird, und stossen „tierische Laute” aus (590 f.). Ganz anders die Vögel in „Martinas” Haushalt: Hier entwirft Duvanel positive Beispiele für einen Umgang mit Alterität. Vielleicht wird so auch die Tragik der eigenen Lebensgeschichte überschrieben – ein safe space, wie ihn „Martinas” Familie den Vögeln bietet, war der Haushalt von Joseph Duvanel für Mutter und Tochter eben gerade nicht.23
Und wenn die Vögel Empathie erfahren, so lehren sie die Menschen vice versa die Einfühlung in andere und die Verbindung mit der Natur überhaupt: In Vogel-Ehe (28. März 1977) enthüllt „Martina” den Grund für den Hauszoo.24 Er wurde für die oft erwähnte Tochter angelegt: „wir finden es gut, wenn ein Stadtkind, das der Natur entfremdet wird, sich um ein Tier kümmern, es beobachten und lieben darf”. Die Kommunikation zwischen Mensch und Tier und genauer Mensch und Kind, die in Was die Schnecke erlebte bis zur Gewalt eskalierte, erscheint hier als ‚natürlich’ und positiv.25 In dieser Hinsicht könnte man behaupten, dass die unterhaltsamen Tierkolumnen didaktischer funktionieren als die zynischen Fabel-Variationen der 1960er, was sicher auch durch das Kolumnenformat in einer Tageszeitung mit breitem Publikum bedingt ist. Duvanel erweist sich damit in ihren ‚Tiertexten’ als vielseitige und adressatenbewusste Schriftstellerin.
Das zutiefst ernste Interesse an Gemeinsamkeit trotz Differenz scheint auch in harmloseren, eindeutig komödiantisch ausgelegten Vogel-Kolumnen durch. In der Sommerfrische (28. Juli 1977) etwa handelt von zwei Vögeln, die sich eigentlich spinnefeind sind: „[A]ls die beiden Vögel einmal in der Küche fliegen durften, stürzte sich der grosse Beo auf den kleinen Fink und hätte ihn zerhackt, wenn wir nicht eingegriffen hätten.”26 Doch bei ihren Balkonferien im Käfig befreunden sie sich; sie
sitzen beide so nah wie möglich beieinander und unterhalten sich durch die Gitterstäbe. Der Beo sieht rührend aus, wie er da ganz gegen seine Gewohnheit am Boden hockt, den Kopf lauschend erhoben, und auf jede Ausserung [sic] des Finken antwortet, wobei er die Stimme des anderen Vogels imitiert – also quasi in dessen Sprache spricht. Ueber was sie wohl reden? Vielleicht über die Gegend: ‚Ich vermisse ein Gewässer,’ sagt der Beo, ‚man erholt sich an einem See oder Fluss viel besser.’ ‚Auch mehr Bäume wären angenehm,’ meint der Grünfink. Beide sprechen mir aus der Seele…
Der Text erzählt von einer Übersetzungsleistung, die er sogleich selbst vollbringt – der Beo „imitiert” die Sprache des anderen Vogels, und die Autorin übersetzt den Vogeldialog in Menschensprache. Die verbreitete Auslegung des Sprechens von Vögeln als ‚Imitation’ scheint auf, doch diese ‚Imitation’ wird zur Basis einer echten Kommunikation, egal wie floskelhaft sie auch sein mag. Duvanel macht so im leichten Unterhaltungstext auch spielerisch den projektiven Charakter eines Schreibens und Sprechens über Tiere deutlich, dem stets ein „selbstreflexives Moment” eignet.27
III. Duvanels Tierbilder: Grenzüberschreitungen und verunsichertes Menschsein
Duvanels Literatur ist voll von Grenzüberschreitungen, die unter anderem durch Sprachbilder entstehen. Ihre Natur „ist magisch belebt, bewegt als personifizierte Akteurin den städtischen Raum”, schreibt Elsbeth Dangel-Pelloquin.28 Duvanel verwendet dabei nicht nur die klassische rhetorische Figur des Anthropomorphismus,29 versieht also Naturkräfte und -dinge mit menschlichen Zügen, sondern sie stattet sie ebenso mit tierischen Attributen aus, und drittens und im selteneren Fall betreibt sie eine Art Mechanisierung, das bildliche Verbinden der Domäne der Natur oder Umwelt und des Maschinellen, wie in einem von Dangel-Pelloquin genannten Beispiel: „Die Nacht fährt langsam davon wie ein Lift”.30 Durch alle diese Verfahren erscheint Umwelt bei Duvanel als etwas Aktives, Handelndes, wie sich an einigen Erzählungen aus dem Band Anna und Ich (1985) hervorragend zeigen lässt. „Die Bäume verdecken ihr Skelett nur notdürftig mit dem grünen Fleisch”, während der „Efeu” das Haus „wie ein Fell” „kleidet”, heisst es in der Erzählung Im Garten; in Die Wirklichkeit, die nackte Wahrheit „trippeln am Morgen” „[k]leine, weiße Wolken […] um die Sonne”, während die Protagonistin Alma „mit ihrer Topfpflanze” „spricht”, „die weder weiblich noch männlich ist, sondern sächlich; ein kleines grünes Kind, immer durstig und sehr still, sehr demütig. Der Winter kriecht in der Nacht über jedes parkierte Auto vor dem Haus und hinterlässt einen klebrigen Schleim”, als wäre er ein riesenhaftes Insekt (216 f.). Und in Die erste Betonkirche Europas „hoppelt” ein „braunes Ulmenblatt […] wie ein verletzter Hase vorbei.” (222) Duvanels Sprache entspricht dem, was Deleuze und Guattari in Für eine kleine Literatur als charakteristisch für Kafka und sein Vermeiden von klassischen Metaphern ausmachen:
[D]ie Worte sind nicht ‚wie’ Tiere, sondern klettern selber empor, bellen oder wimmeln in ihrer Eigenschaft als Sprachhunde, Sprachinsekten oder Sprachmäuse. […] Desgleichen gibt es auch nicht mehr ein ‚erstes’ Subjekt der Aussage und ein ‚zweites’ des Ausgesagten: Das zweite Subjekt ist nicht Hund, während das erste weiterhin ‚wie’ ein Mensch bleibt; das erste Subjekt ist nicht ‚wie’ ein Mistkäfer, während das zweite weiterhin Mensch bleibt. Es gibt nur noch einen einzigen Stromkreis von Zuständen, der sich, inmitten einer zwangsläufig vielfältigen oder kollektiven Verkettung, zu einem umfassenden Werden, einem Prozeß schließt.31
Die in solchen Passagen direkt oder indirekt aufgerufenen Tiere wären, mit Borgards Terminologie, als non-diegetisch oder semiotisch zu bezeichnen, da sie nicht in der Welt der Erzählung als handelnde Figuren auftreten. Allerdings erhält die Natur und Umwelt über diese sie ‚belebenden’ Sprachbilder eine Handlungsmacht, die die der menschlichen Figuren bedroht: Sie sind stets einem grossen, sie überall umgebenden Anderen ausgeliefert.
Wenn die Natur vermenschlicht oder ‚vertiert’ wird, so kippen gleichzeitig menschliche Figuren auf der Sprach- und Bildebene ins Objekthafte, Mechanische, oder, hier besonders interessant, Tierische. Im einfachsten Fall bemüht Duvanel explizite Tiervergleiche: Die Hauptfigur aus „Luzia mit vierzehn Jahren” (1976) wird „‚Meerschweinchen’ genannt”, da ihr „wirbliges, blassrotes Haar” ebenso wie ihr „Gesicht” und ihre Mimik an die Tiere erinnert (29). Die Hauptfigur aus Häslein in der Grube (1988) wird von den Kindern nach dem titelgebenden Tier gerufen, da sie konstant „hoppelt” und anscheinend in einer „Grube” nächtigt (275 f.). Die Nachbarin (1980) aus der gleichnamigen Erzählung lebt mit „ihrer Schildkröte allein”, und hier wird der Vergleich Mensch-Tier nur in der Möglichkeitsform, aber in dieser eben doch gemacht: „Ich könnte allerdings jemandem eine Bemerkung über das grämliche Tier in den Mund legen, ihn zum Beispiel feststellen lassen, der Hals der Nachbarin gleiche dem Hals der Schildkröte.” (64) Und eine Figur in Das verschwundene Haus (1988) sieht sich selber als „Fisch, der in” einem „hohlen Baum wohnte” (257). Das Motiv eines Fisches im hohlen Baum kehrt übrigens in einer fast zeitgleich entstandenen Zeichnung wieder (Abb. 1), die damit möglicherweise – wie andere Zeichnungen Duvanels – als Illustration konzipiert war.32

Strukturell leitend ist der Mensch-Tier-Vergleich auch in der Erzählung Neid (1980): Eine „vermisste[] Schwester” wird sprachlich und zuletzt auch auf der Ebene der Handlung zum Tier, was zeigt, wie eng bildhafte Vergleiche und Metaphern mit einer faktischen Auflösung der Grenze zwischen den Spezies zusammenhängen. Zuerst „nagt” die Schwester „blitzschnell an Äpfeln, Karotten und Seifen mit ihren merkwürdig halbkreisförmig gekrümmten Schneidezähnen” (34); zuletzt taucht sie als „großes, rattenähnliches Tier” mit „goldene[n] Ringe[n] in seinen Ohren” im Park auf (35), eine unheilvolle ‚Verwandlung':
Da ich weiß, dass sich Ratten für verschiedene Versuche eignen und die Wissenschaftler an ihnen Interesse haben, berichtete ich einige Wochen später der Polizei aus Neid, was sich im Park zugetragen hatte. Falls es gelingt, meine Schwester einzufangen, wird man versuchen, einen Menschen aus ihr zu machen. (35 f.)
Diese radikale Verkehrung, in der statt einem Tier- sozusagen ein Menschenversuch angestellt werden soll, weist auf die fundamentale ontologische Verunsicherung, die aus Duvanels Texten spricht: Wem Handlungsmacht und ‚Identität’ zukommen und wem nicht, ist höchst fraglich.33 Dieses Kernthema wird immer wieder über die Tiermotivik verhandelt. So „kreisch[t]” etwa die Erzählstimme aus Raymond gibt es nicht (publiziert am 4.1.1970 in den Basler Nachrichten) innerlich, schlägt „mit den Flügeln und hack[t] gegen” das Ohr ihrer Tochter (678), während sie eine Art Selbstverlust erlebt: Ihre Identität erfährt sie als „bedroht”, denn „[j]ede Grenze kann man übertreten” (675). Und die schon erwähnte „Luzia mit vierzehn Jahren” möchte eine Lebensbeschreibung verfassen:
Aber vielleicht war sie weder so, wie sie sich, noch so, wie ihr Vater sie sah? Gab es Menschen, die ihr ganzes Leben lang niemand richtig kannte, nicht einmal sie selbst? Man bestand aus tausend Bildern; wenn einen ein Greis, die Mutter, der Geliebte, ein kleines Kind oder ein Hund betrachteten, wurde man zu fünf verschiedenen Personen; und wenn einen jemand aus der Höhe anschaute, oder aus der Ferne, oder durch ein riesiges Mikroskop… Und es gab Geisteskranke, die sich selber als Tier sahen, oder als eine Berühmtheit, oder als Gott, oder als Teufel. Waren sie es nicht? Für die andern nicht, aber für sich selber gewiss […]. (32)
Zuerst sind es unter anderem der tierische Blick eines „Hund[es]” und der ‚wissenschaftliche’ Blick „durch ein riesiges Mikroskop”, als wäre man ein Insekt, der das Selbst fragmentiert. Dann ist es die Möglichkeit, sich selber „als Tier” zu sehen, die das Selbst zerfallen lässt, denn ein solches Selbst ist „für sich selber” ein Tier und kein Mensch. In Duvanels Werk entsteht so auch über die zahlreichen Tierbilder und -vergleiche eine „anthropologische[] Verunsicherung”,34 wie in der eingangs zitierten Erzählung Die Ordnung, in der ja eine Erzählerin nicht weiss, ob sie einen Menschen oder ein vogelähnliches Monstrum gebären wird. Dass dieses Moment in Die Ordnung gerade mit einer Schwangerschaft assoziiert ist, kommt nicht von ungefähr, kann man eine solche doch mit Jean-Luc Nancy als Moment der Vereinigung mit dem Anderen begreifen,35 eine Vereinigung, die nicht nur Erfüllung, sondern auch tiefe existenzielle Verunsicherung mit sich bringt.
Auch im noch sehr wenig bekannten Bildwerk36 ist die Grenze zwischen Mensch und Tier durchlässig. Duvanel, die als Kind Schreiben und Malen als gleichwertige künstlerische Aktivitäten betrieb, musste während ihrer Ehe mit Maler Joseph Duvanel auf seinen Druck hin auf die Malerei verzichten. Erst nach der Scheidung in den 1980ern schuf sie einen Grossteil der oft farbenfrohen, im Dargestellten aber so gar nicht frohen Zeichnungen, die sich im Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv sowie in den Beständen des open art museum in St. Gallen erhalten haben. Darunter finden sich auch als Illustrationen konzipierte Werke, so zum Beispiel die zur Erzählung Die Reisegefährten gehörige Zeichnung einer Frau, die ein Glas Wein in ihr Herz schüttet.37 An der Wand hängt ein Bild, das eine Frau in einer Paarkonstellation mit einem menschengrossen und vogelähnlichen Wesen zeigt (Abb. 2). Die Konstellation Riesenvogel-Mensch findet sich auch in einer von Henke ausführlich analysierten Zeichnung, in der sich ein Kind oder eine Frau mit einem Papagei unterhält, während ein Engel seinen/ihren Kopf spaltet (Abb. 3).38


Tiere wandeln manchmal als am Geschehen seltsam unbeteiligte Wesen durchs Bild, so zum Beispiel zahlreiche Katzen oder Füchse (Abb. 4);39 manchmal dominieren sie die Szenerie auf implizit bedrohliche Weise, wie im Falle eines Riesenfischs und Riesenvogels, die im Hintergrund lauern (Abb. 5);40 dann wieder bedrohen sie die Figuren im Bild explizit, teils als seltsame Monstren, die sich nicht eindeutig auf eine Gattung festlegen lassen (Abb. 6).



Besonders eindrücklich ist die Zeichnung einer zum Himmel flehenden Sphinx mit Frauenkopf und Schlangenkörper (Abb. 7), die auf Jane Graverols surrealistische Ikone L’École de la vanité (1967) verweist. Doch während Graverols Sphinx als Bild einer modernen Weiblichkeit lesbar wird, die selbstbewusst zwischen dem Monströsen, dem Mechanischen und dem Verführerischen changiert, setzt Duvanel die Verzweiflung eines Mischwesens ins Bild, das schon durch die christliche Interpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte auf seine Sündhaftigkeit festgeschrieben ist – die zur Sünde verführende Schlange und die ihr verfallende Frau werden Eins. Die Grenzüberschreitung Tier-Frau verspricht hier keine Heilung.

IV. Schluss
In Adelheid Duvanels Literatur vollzieht sich eine Art Animal Turn, wie er seit der Jahrtausendwende theoretisiert wird. In der kulturwissenschaftlichen Beschäftigung mit Tieren wird ein vernetztes Denken angestrebt, in dem nicht mehr (nur) der Mensch im Zentrum steht.41 Auf Duvanels Texte trifft zu, was Conrad über ihr Korpus aus Tiertexten der Gegenwartsliteratur schreibt: Das Zusammenbringen des Menschlichen und des Tierischen in Form von Grenzüberschreitungen „can potentially unhinge expectations and challenge preconceptions about specific categories: e.g., ‚human’ or ‚animal,’ ‚dead’ or ‚alive,’ ‚self’ or ‚other’.”42 Wenn die Grenzen zwischen Mensch und Tier problematisiert werden, stehen auch Konzepte wie Identität, Handlungsmacht und Freiheit zur Debatte, traditionell den Menschen vorbehaltene Privilegien. Anstatt die Dualismen Tier-Mensch, Natur-Kultur oder auch Natur-Geist zu reproduzieren, vollzieht Duvanel in ihrem Werk kreative Grenzüberschreitungen, die über Tiere und Tierbilder den Blick auf die Menschen zurückwenden und ihre Handlungsmacht sowie die vermeintlich rationale Verfasstheit des Selbst und der Welt radikal in Frage stellen. Insofern bleibt sie einem gewissen Anthropozentrismus verhaftet – auch wenn in ihren Texten Mischwesen und Tiere die Handlung tragen oder prägen, scheint zumeist eine Aussage über das Menschliche im Kontext des oder in Konfrontation mit dem ‚Fremden’ von Interesse zu sein. Und doch begegnet man ihren tierischen und hybriden Figuren lesend mit Neugier, Irritation oder Empathie – man könnte Duvanels Texte so vielleicht auch als Einübung in ein Denken und Erzählen begreifen, das sich für ‚das Andere’ öffnet, für radikale Differenz.43
Jedes Unterkapitel hat eine je neue Facette von Duvanels Schreiben von und mit Tieren sichtbar gemacht: Anhand der Fabel-Variationen der 1960er wurde gezeigt, dass Duvanel mit ihren Tierfiguren davon erzählt, wie Lebewesen einander fundamental missverstehen und fremd bleiben, ein Konzept von scheiternder Kommunikation, das hier auf die Differenz zwischen Spezies übertragen wird und ironischerweise gerade dort greift, wo Tiere ‚vermenschlicht’ werden. In den Tierkolumnen der 1970er wiederum führt Duvanel einen positiven und reflektierten Umgang mit Alterität vor; die Haustiere erhalten Räume, in denen sie trotz ihrer Traumata angenommen werden, ein Glück, das Duvanels menschlichen Figuren oft versagt bleibt. Und das dritte Unterkapitel führte ganz unterschiedliche Grenzüberschreitungen und ihre Weiterungen für die Erzähl- und Darstellungsperspektive sowie für den Handlungsspielraum der Figuren im Text vor Augen. Aus der Auflösung von Grenzen — zwischen Lebewesen, Lebewesen und Objekten, Menschen und Tieren, Naturkräften und Tieren – resultiert die ontologische Verunsicherung, durch die Duvanels Figuren und Texte geprägt sind.
Literatur
Baum, Angelica: «Ich schreibe in einer ganz grossen Einsamkeit». Zu den Briefen von Adelheid Duvanel. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 82-91
Borgards, Roland: Tiere in der Literatur. Eine methodische Standortbestimmung. In: Herwig Grimm/Carola Otterstedt (Hrsg.): Das Tier an sich. Disziplinenübergreifende Perspektiven für neue Wege im wissenschaftsbasierten Tierschutz. Göttingen 2012, S. 87–118
Borgards, Roland: Einleitung: Cultural Animal Studies. In: Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 2016, S. 1-5
Conrad, Jennifer L.: Becoming Nonhuman: Uncanniness, Impossibility and Human-Animal Indistinction in Recent Literature and Visual Art. ProQuest Dissertations & Theses Global. University of Wisconsin, MadisonProQuest 2017
Dangel-Pelloquin, Elsbeth: Absage an die Spielregeln unserer Welt. Die Poetik der Adelheid Duvanel. In: Duvanel, Adelheid: Fern von hier. Sämtliche Erzählungen. Zürich 2021, S. 747–770
Deleuze, Gilles und Guattari, Félix: Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt am. M. 1976
Doderer, Klaus: Fabeln. Formen, Figuren, Lehren. München 1982
[Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne – Finderli. In: Doppelstab, 28. Februar 1977
[Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne – Der finstere Ruby. In: Doppelstab, 14. März 1977
[Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne – Vogel-Ehe. In: Doppelstab, 28. März 1977
[Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne – In der Sommerfrische. In: Doppelstab, 28. Juli 1977
Duvanel, Adelheid: Fern von hier. Sämtliche Erzählungen. Hrsg. v. Elsbeth Dangel-Pelloquin. Zürich 2021
Duvanel, Adelheid: Nah bei dir. Briefe 1978-1996. Hrsg. v. Angelica Baum. Zürich 2024
Egyptien, Jürgen: Adelheid Duvanel. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartliteratur (online, www.nachschlage.NET/document/16000000117
Henke, Silvia: Lust und Schrecken: Ein längerer Blick auf einige Zeichnungen von Adelheid Duvanel. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 74-81
Jagfeld, Monika: Chronistin der Unangepassten. In. Dies. (Hrsg.): Wände dünn wie Haut. Zeichnungen und Gemälde der Schweizer Schriftstellerin Adelheid Duvanel, St. Gallen 2009, S. 8-30
Jagfeld, Monika: Adelheid Duvanel, Malerin mit Worten und Farben. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 54-62
Jahn, Bernhard/Neudeck, Otto (Hg.): Tierepik und Tierallegorese. Studien zur Poetologie und historischen Anthropologie vormoderner Literatur. Frankfurt a. M. u. a. 2004
Kathleen Kete: Verniedlichte Natur. Kinder und Haustiere in historischen Quellen. In: Dorothee Brantz, Christof Mauch (Hrsg.): Tierische Geschichte. Die Beziehung von Mensch und Tier in der Kultur der Moderne. Paderborn et al. 2010, S. 123-137
Krayfuss, Gudrun S.: Scheherezadel. Eine Basler Autorin wird entdeckt. Reflexionen zu Leben und Schaffen von Adelheid Duvanel. Laufen 1998
Kynast, Katja: Geschichte der Haustiere. In: Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 2016, S. 130-138
Małecki, Wojciech et al.: Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care about Other Species. London 2019
Maye, Harun: Tiere und Metapher. In: Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 2016, S. 37-45
Meyer, Valerie: «Ich kenne nicht sehr viele Worte» – Adelheid Duvanels Erzählen in den 1960er Jahren. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 32-38
Nancy, Jean-Luc: Being Singular Plural. Stanford 2000
Nowotny, Joanna: Kippmomente. Adelheid Duvanels Ästhetik am Abgrund in Text und Bild. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 64-73
Weder, Christine: Kalendergeschichten? Kurzprosa und Kolumnen von Adelheid Duvanel. In: Christoph Hamann/Rolf Parr (Hrsg.): Getaktete Zeiten. Von Kalendern und Zeitvorstellungen in Literatur und Film. Berlin u.a. 2022, S. 95-106
Weder, Christine: »Dem Leben und seinen kalten Anforderungen nicht gewachsen«: Adelheid Duvanel über Robert Walser und die kleine Form. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 67 (2023 [2024]), S. 203-226
Weder, Christine: In aller Öffentlichkeit versteckt. Adelheid Duvanel als Kolumnistin. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 26-30
Wernli, Martina: Und wer liest Adelheid Duvanel? Zu Mehrfachmarginalisierungen
und Kanonisierungsfragen am Beispiel einer wiederzuentdeckenden Autorin. In: literatur für leser:innen 43 (2023), H. 2, S. 133-145
- Duvanel, Adelheid: Fern von hier. Sämtliche Erzählungen. Hrsg. v. Elsbeth Dangel-Pelloquin. Zürich 2021, S. 224. Diese Ausgabe wird in der Folge mit Seitenzahl in Klammern im Fliesstext zitiert. ↩
- Eine Zusammenstellung von Rezensionen zu Fern von hier findet sich im Anhang des online-KLG-Artikels von Jürgen Egyptien: Adelheid Duvanel. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartliteratur (online, www.nachschlage.NET/document/16000000117, Stand: 01.04.2022). ↩
- Im Sommer 2024 erschien die 53. Ausgabe der Zeitschrift Quarto des Schweizerischen Literaturarchivs, die Duvanel gewidmet ist und u.a. Beiträge von Beatrice und Peter von Matt enthält. Weitere wichtige Beiträge aus den letzten Jahren sind: Dangel-Pelloquin, Elsbeth: Absage an die Spielregeln unserer Welt. Die Poetik der Adelheid Duvanel. In: Duvanel, Adelheid: Fern von hier. Sämtliche Erzählungen. Zürich 2021, S. 747-770; Weder, Christine: »Dem Leben und seinen kalten Anforderungen nicht gewachsen«: Adelheid Duvanel über Robert Walser und die kleine Form. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 67 (2023 [2024]), S. 203-226; Dies.: Kalendergeschichten? Kurzprosa und Kolumnen von Adelheid Duvanel. In: Christoph Hamann/Rolf Parr (Hrsg.): Getaktete Zeiten. Von Kalendern und Zeitvorstellungen in Literatur und Film. Berlin u.a. 2022, S. 95-106; Wernli, Martina: Und wer liest Adelheid Duvanel? Zu Mehrfachmarginalisierungen und Kanonisierungsfragen am Beispiel einer wiederzuentdeckenden Autorin. In: literatur für leser:innen 43 (2023), H. 2, S. 133-145. ↩
- Über die Biografie gibt die soeben erschienene Briefausgabe Aufschluss: Duvanel, Adelheid: Nah bei dir. Briefe 1978-1996. Hrsg. v. Angelica Baum. Zürich 2024. Vgl. Fn 24 für mehr Informationen und Literaturhinweise. ↩
- Borgards, Roland: Tiere in der Literatur. Eine methodische Standortbestimmung. In: Herwig Grimm/Carola Otterstedt (Hrsg.): Das Tier an sich. Disziplinenübergreifende Perspektiven für neue Wege im wissenschaftsbasierten Tierschutz. Göttingen 2012, S. 87–118, hier S. 89. ↩
- Zwischen Name und Realität tut sich sofort eine Kluft auf, wenn im „Gehege vor der Abteilung F” „traurig zerfallende, sich dahinschleppende Fleischreste mit verzetteltem Geist” „[]schlufen” (588). ↩
- Ebenfalls einschlägig wäre die absurde Erzählung Wiborada und das Wildschweinchen (610 f.), die jedoch mit Anleihen an andere Gattungen spielt und hier deswegen nicht im Zentrum steht. ↩
- Vgl. zur Geschichte und Theorie der Gattung Klaus Doderer: Fabeln. Formen, Figuren, Lehren. München 1982. ↩
- Wobei diese Fertigkeit im Falle Rotpeters nach dem Handschlag, dem Spucken und dem Trinken von Alkohol kommt – ein vernichtendes Urteil darüber, was es heisst, menschlich zu sein. ↩
- Vgl. zur Janusköpfigkeit der Verweise auf ‚grosse’, kanonisierte männliche Autoren wie Kafka oder Robert Walser, wie sie bei Duvanel besonders gerne angestellt werden, Weder, »Dem Leben und seinen kalten Anforderungen nicht gewachsen« (Anm. X), S. 208. ↩
- Vgl. Kynast, Katja: Geschichte der Haustiere. In: Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 2016, S. 130-138. ↩
- Conrad, Jennifer L.: Becoming Nonhuman: Uncanniness, Impossibility and Human-Animal Indistinction in Recent Literature and Visual Art. ProQuest Dissertations & Theses Global. University of Wisconsin, MadisonProQuest 2017, S. 213. ↩
- In einer für Duvanels Literatur typischen metonymischen Übertragung wird das Summen der imaginierten Bienen im Text zum Surren der Nähmaschine, die die titelgebende Naht produziert. ↩
- Die enge Verbindung von Märchen- und Fabelmotiven bei Duvanel zeigt sich auch in Ein Hahn namens Eugen, der mit der Märchenformel „Es war einmal” beginnt (605). ↩
- Alle Zitate aus den Tierkolumnen stammen aus Belegen der Basler Zeitung Doppelstab, die sich (als einzelne Seiten) im Nachlass Adelheid Duvanel im Schweizerischen Literaturarchiv befinden (Signatur: SLA-AD-D-14). Die Übergabe der Kolumnen, die aus der Sammlung von Adelheid Duvanels Bruder Felix Feigenwinter stammen, wurde durch Elsbeth Dangel-Pelloquin vermittelt ↩
- Weder, Christine: In aller Öffentlichkeit versteckt. Adelheid Duvanel als Kolumnistin. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 26-30, hier S. 28. „Martina” bedient zu dieser Zeit ebenso das Kolumnen-Format Allzu Privates; vgl. dazu ebd. In Bälde wird das gesamte Kolumnenwerk, damit auch die Tiergeschichten, in einer von Christine Weder besorgten Edition greifbar (erscheint voraussichtlich bei Limmat 2025). In Anbetracht der momentan noch schwierigen Quellenlage liegt der Fokus meiner Erörterungen auf einigen Kolumnen, die über eine Sammlung von Felix Feigenwinter in den Nachlass am Schweizerischen Literaturarchiv eingegangen sind. ↩
- Weder, In aller Öffentlichkeit versteckt, S. 28. Zur langen literarischen Geschichte von Vögeln überhaupt vgl. den Beitrag im vorliegenden Heft: Weber, Ulrich: Vogts Vögel. ↩
- Der „Papagei” aus der Kolumne Finderli erscheint wieder als Ruby aus Der finstere Ruby, der „Wellensittich Bussi” aus Vogel-Ehe frisst Finderli das Futter weg und „richtete es zweimal übel zu”, Beo kommt namentlich in Vogel-Ehe und In der Sommerfrische vor, und In der Sommerfrische erscheint ein Grünfink, der im Textkorpus als „Finderli” lesbar wird. ↩
- [Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne – Finderli. In: Doppelstab, 28. Februar 1977. ↩
- [Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne – Der finstere Ruby. In: Doppelstab, 14. März 1977. Ein herzlicher Dank für die genaue Datierung der Tierkolumnen, die im Nachlass als Zeitungsausschnitt ohne Kontext erhalten sind, geht an Christine Weder (Bern, Juli 2024). ↩
- Dasselbe geschieht in der etwas später entstandenen Erzählung Der Vogel (1978); vgl. Weder, In aller Öffentlichkeit versteckt, S. 28. ↩
- An einer Stelle wird diese Verbindung Ehemann-Vogel für einen subtilen Seitenhieb genutzt: In Vogel-Ehe (28. März 1977) liebt der Vogel Orly es, „sich auf das Klavier zu setzen und, während mein Mann Skrijabin oder Fauré spielt, wunderschön zu singen; wenn mein Mann aufhört, unterbricht auch Orly seinen Gesang, und sobald er weiterfährt, schmettert unser kleiner Caruso seine Arien von neuem.” Kurz darauf heisst es, dass dieser Orly mit einem weiblichen Vogel liiert ist, einem „‚Räf': zänkisch und autoritär, aber erstaunlich intelligent – was vielleicht ihren musischen, aber dummen Gatten am meisten ärgerte…” ↩
- Joseph Duvanel bekam 1969 einen Sohn mit einer Geliebten und Adelheid Duvanel lebte fortan in einer erzwungen ‚offenen’ Beziehung, in der sie nicht nur Lohn-, sondern auch Sorgearbeit nicht nur für den Mann, sondern auch für den ‚Pflegesohn’ leistete (unter diesem Begriff erscheint er in „Martinas” Kolumnen Allzu Privates). In Briefen berichtet sie, wie gefährdet die Tochter in der labilen Situation war; mit zwölf Jahren wurde sie vom Vater missbraucht, mit nur vierzehn Jahren geriet Adelheid Duvanel junior in die Drogenszene (vgl. Duvanel: Nah bei dir; besonders einschlägig sind die Briefe an Maja Beutler, die in deren Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv liegen, Signatur: SLA-Beutler-B-2-DUV, hier bes. der Brief vom 9.10.1992, abgedruckt in Nah bei dir, S. 636-642). Vgl. zur Biografie allgemein Baum, Angelica: «Ich schreibe in einer ganz grossen Einsamkeit». Zu den Briefen von Adelheid Duvanel. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 82-91; Jagfeld, Monika: Chronistin der Unangepassten. In. Dies. (Hrsg.): Wände dünn wie Haut. Zeichnungen und Gemälde der Schweizer Schriftstellerin Adelheid Duvanel, St. Gallen 2009, S. 8-30; Jagfeld, Monika: Adelheid Duvanel, Malerin mit Worten und Farben. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 54-62; Krayfuss, Gudrun S.: Scheherezadel. Eine Basler Autorin wird entdeckt. Reflexionen zu Leben und Schaffen von Adelheid Duvanel. Laufen 1998. ↩
- [Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne — Vogel-Ehe. In: Doppelstab, 28. März 1977. ↩
- Die Vorstellung einer Art natürlichen Verbindung zwischen Kind und Tier, die der ‚Entfremdung’ des Stadtlebens entgegenwirkt, hat eine lange Tradition. Vgl. Kathleen Kete: Verniedlichte Natur. Kinder und Haustiere in historischen Quellen. In: Dorothee Brantz, Christof Mauch (Hrsg.): Tierische Geschichte. Die Beziehung von Mensch und Tier in der Kultur der Moderne. Paderborn et al. 2010, S. 123-137, hier S. 124. ↩
- [Duvanel, Adelheid:] Unsere Tierkolumne – In der Sommerfrische. In: Doppelstab, 28. Juli 1977. ↩
- Maye, Harun: Tiere und Metapher. In: Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 2016, S. 37-45, hier S. 40. ↩
- Dangel-Pelloquin: Absage an die Spielregeln unserer Welt, S. 755. ↩
- Der Begriff ist hier angemessener als die von Dangel-Pelloquin bemühte Personifizierung („personifizierte Akteurin”), da bei Duvanel weniger einem gestaltlosen Abstraktum eine menschliche Gestalt gegeben, sondern viel eher konkret erfahrbare Phänomene mit menschlichen Eigenschaften aufgeladen rsp. durch sie gedeutet werden. ↩
- Zitiert bei Dangel-Pelloquin: Absage an die Spielregeln unserer Welt, S. 755; Originalzitat aus Frau Leisegangs Besitz (in Fern von hier, S. 517). ↩
- Deleuze, Gilles und Guattari, Félix: Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt am. M. 1976, S. 32. ↩
- Vgl. zu Illustrationen von Duvanel Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 18 und 37. ↩
- Vgl. dazu Nowotny, Joanna: Kippmomente. Adelheid Duvanels Ästhetik am Abgrund in Text und Bild. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 64-73, hier v.a. S. 69. ↩
- Jahn, Bernhard/Neudeck, Otto (Hrsg.): Tierepik und Tierallegorese. Studien zur Poetologie und historischen Anthropologie vormoderner Literatur. Frankfurt a. M. u. a. 2004, S. 10. ↩
- Nancy, Jean-Luc: Being Singular Plural. Stanford 2000, S. xiii. ↩
- 2009 erschien der Katalog einer Ausstellung, der erstmals einen Teil des Bildwerks zugänglich macht: Monika Jagfeld (Hrsg.), Wände dünn wie Haut. Zeichnungen und Gemälde der Schweizer Schriftstellerin Adelheid Duvanel, Katalog zur Ausstellung, St. Gallen, Museum im Lagerhaus 2009. Soeben erschien eine Duvanel gewidmete Ausgabe der Zeitschrift Quarto, die erstmals Text- und Bildwerk (v.a. den im Nachlass Duvanel des Schweizerischen Literaturarchivs befindlichen Teil) nebeneinanderstellt: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel); vgl. zum Zusammenspiel zwischen Text- und Bildwerk besonders auch Nowotny: Kippmomente. ↩
- Freundlicher Hinweis von Angelica Baum, Februar 2024; vgl. auch Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 18. ↩
- Henke, Silvia: Lust und Schrecken: Ein längerer Blick auf einige Zeichnungen von Adelheid Duvanel. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 74-81, hier S. 79 f. Es wäre hinzuzufügen, dass die Zeichnung durch zahlreiche Motive – Konstellation Engel/Frau, Fenster im Hintergrund, Lichteinfall – die Verkündigung an Maria aufruft. Handelt es sich hierbei um Duvanels ‚Verkündigung’, ist die Aussage des Bilds jedoch eine ganz andere: Die Frau kehrt dem Engel den Rücken zu, spricht lieber mit dem Märchenvogel, und der feierliche Akt wird zur brachialen, potenziell mörderischen Gewalt. ↩
- Vgl. auch zu dieser Zeichnung Henke: Lust und Schrecken, S. 76 f. ↩
- Die Fischmotivik ist bei Duvanel besonders einschlägig. Über sie lässt sich ein Bogen zu den Erzählungen schlagen: In Der Dichter erscheint das Schreiben als Möglichkeit, „über der großen Leere, über dem Abgrund, in den mein Leben gefallen ist, eine neue Welt [zu] schaffen”, und die erzählende Figur „mal[t]” mit dem „Klang” der Worte etwa „einen tollwütigen Fisch”, der vor ihrem „Fenster treib[t]” (9). Die synästhetische Qualität einer solchen Passage ist charakteristisch für die Poetik und Ästhetik der malenden Schriftstellerin; vgl. dazu auch Nowotny: Kippmomente, S. 66; Jagfeld: Malerin mit Worten und Farben; Meyer, Valerie: «Ich kenne nicht sehr viele Worte» –Adelheid Duvanels Erzählen in den 1960er Jahren. In: Quarto. Bern 2024, Nr. 53 (Adelheid Duvanel), S. 32-38, hier bes. S. 33 f. ↩
- Borgards, Roland: Einleitung: Cultural Animal Studies. In: Borgards, Roland (Hrsg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 2016, S. 1-5. ↩
- Conrad: Becoming Nonhuman, S. 209. ↩
- In dieser Hinsicht könnte man Duvanels Texte möglicherweise ähnlich lesen wie das Korpus der grossen Studie von Wojciech Małecki et al., die dem Effekt von Tiererzählungen auf Leser*innen nachspüren und konstatieren, dass sie die Einfühlung in und Empathie für andere Spezies schulen; vgl. Małecki, Wojciech et al.: Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care about Other Species. London 2019. ↩