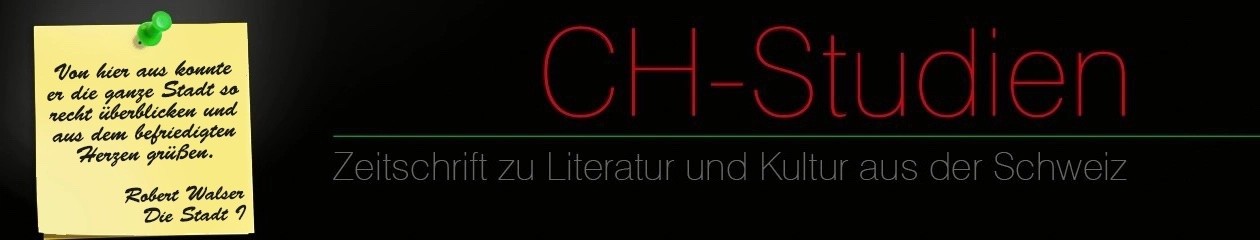Zwei Themen wird in der neuen Ausgabe von „CH-Studien” nachgegangen – erstens den Stadttopographien, zweitens den Tieren in der Deutschschweizer Literatur.
Mitte der 1990er Jahre initiierte der Geograph und Urbanist Edward W. Soja eine Wende, die nachträglich als „spatial turn” bezeichnet wurde und ein großes Interesse in der kulturwissenschaftlich orientierten Literaturforschung weckte. Von Sojas Grundprämisse ausgehend, die besagt, dass die real existierenden Räume nicht ohne ihre imaginierte Dimension gedacht werden können – und umgekehrt –, wird der Raum als eine bedeutende Konstituente der fiktiven Welt wesentlich aufgewertet. In der Folge der Forschungswende entstanden literaturwissenschaftliche Analysen, in denen man sich den fiktiven Orten im Werk einzelner Autoren, Regionen, Städten oder der Raumgestaltung in literarischen Genres zuwendet. In diesem Kontext ist u.a. die dritte Nummer des „Jahrbuchs der Literaturen der Schweiz” Viceversa zu sehen, die den fiktiven Orten in der Literatur gewidmet ist. In drei Essays wird den literarischen Orten nachgegangen, die in drei Literaturen der Schweiz präsent sind und das imaginierte Bild des Landes mitprägen. Wie die Herausgeber angeben, ging es ihnen um die Skizze einer „literarischen Landkarte” der Schweiz. So setzt Dominik Müller mit Gottfried Kellers Heimatstadt Zürich an, die am Anfang des Grünen Heinrich ausführlich beschrieben wird. An diese wird dann die Evokation einer anderen, fiktiven Heimatstadt des Titelhelden angeschlossen, die den Raum der Keller’schen Phantasie eröffnet. Müller geht in seiner kurzen Darstellung auf weitere vorgestellte Orte wie Unverstand, Güllen, Andorra oder Seldwyla ein, die das schweizerische Imaginarium mitbestimmen und das fiktive Geschehen wesentlich beeinflussen.
Unter scharfem Blick der Schriftsteller werden Strukturen der Städte aufgedeckt, wie in Kurt Martis Essay Blick auf Bern, in dem die Stadt lediglich als Stadtkern definiert und den „Schlafstätten” der Peripherie gegenübergestellt wird. Wenn er dann noch auf die unterirdischen Läufe, Keller oder Theater eingeht, erinnert es an Hugo Loetschers unterirdische Abwasserkanäle, die eine besondere Art Karte nachzeichnen. Die Erstellung der literarischen Landkarten wird zum Ziel eines neuen Forschungsfelds, der „Literaturgeographie”, das von U. Ecos These von der Unmöglichkeit der Existenz einer vollkommen autonomen erzählerischen Welt neben einer realen ausgeht. Im Rahmen der Literaturgeographie wird versucht, einen imaginären Raum zu untersuchen, „der sich gewissermaßen über die reale Geographie legt, sie teils erweitert (mit erfundenen Orten), teils schrumpfen lässt, und sich mit ihr an manchen Stellen auch berührt.” (B. Piatti, 2010) Ein besonders interessantes Projekt, das die Kartographie mit der Literaturwissenschaft verbindet, wird aktuell unter der Leitung von Barbara Piatti und Lorenz Hurni (beide ETH Zürich) realisiert. In der Kooperation der Literaturwissenschaftler mit den Kartographen wird ein literarischer Atlas Europas hergestellt, in dem die Wechselbeziehungen zwischen den realen und fiktiven Orten visualisiert werden und zu neuen Fragestellungen führen können. Eine andere Forschungsperspektive auf die Beschaffenheit der fiktiven Orte eröffnen die Überlegungen von Hartmut Böhme und Florian Rötzer, die die Städte angesichts der zivilisatorischen Veränderungen vor einer „Infokalypse” (H. Böhme) sehen und einen Kollaps der urbanen Funktionen prophezeien. Angesichts der Etablierung der Massen- und Kommunikationsmedien im sozialen und administrativen Bereich kommt es zur Dezentralisierung der Stadt (F. Rötzer), und die Vernetzung von komplexen Überwachungs- und Steuerungssystemen, auf die die heutigen Städte angewiesen sind, führen zur Eroberung der Städte durch die Computer (H. Böhme). In diesem Kontext sprechen beide Forscher von Cyberstädten.
Daniel Rothenbühler untersucht in seinem sich auf das gesamte Schaffen von Jörg Steiner beziehenden Beitrag die Stadttopographie der kleinen Stadt Biel, der Heimatstadt des Schriftstellers. In fast allen seinen Werken hat Jörg Steiner seine Heimatstadt Biel auf die eine oder andere Weise zum Bezugspunkt seines Erzählens gemacht. Ausnahmen bilden einzelne Erzählungen und sein letztes Buch Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean. Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, was sich in dem fortdauernden Bezug auf Biel über das literarische Schaffen dieses Autors offenbaren könnte. Wie die meisten Autoren seiner Generation aus der deutschsprachigen Schweiz lehnte er es ab, sich und seine Lesenden durch die Exotik ferner Orte von „der eigenen Unruhe” ablenken zu wollen. Seine Bezugnahme auf tatsächliche Straßen, Plätze, Gebäude und Gärten Biels lässt er aber immer vom Zweifel am Realitätsgehalt seiner Angaben begleiten. Im Prosaerstling „Eine Stunde vor Schlaf” transformiert er seine Heimatstadt in ein imaginäres Grub, das nur in der Gesamtsicht auf Stadt und Landschaft an Biel erinnert. In den Romanen Strafarbeit und Ein Messer für den ehrlichen Finder hingegen heißt die dargestellte Stadt Biel, lässt sich aber nur durch eine Vielzahl von Teilansichten als diese erkennen. Hier wie in den weiteren Texten, die Steiner von Anfang der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre veröffentlichte, steht der forcierte Bau von Straßen und Hochhäusern paradigmatisch für eine Entwicklung der Schweiz, deren Städte in den 1950er bis 1970er Jahren auch ohne die großen Kriegszerstörungen ihrer Nachbarländer einen radikalen topographischen Wandel erfuhren. Mit dem Erzählband Olduvai von 1985 nimmt Steiner dann Abschied von Biel als Industriestadt im ständigen Umbau. Der Roman Weissenbach und die anderen von 1994 zeigt mit dem fingierten Otterwil, wie die Notabeln einer postindustriellen Kleinstadt auf die großen ökonomischen und politischen Umwälzungen der beginnenden Globalisierung reagieren. Im Zentrum der Stadt steht ein leerer Sockel als Denkmal auf alle vergangenen Denkmäler. In deutlichem Gegensatz dazu folgt die Erzählung Der Kollege dann 1996 dem Gang eines arbeits- und erwerbslosen Außenseiters durch eine Stadt ohne Mitte, die bis in die Einzelheiten als Biel erkennbar ist und den Lesenden trotzdem so fremd vorkommt wie die Randzone einer Metropole. Die Erzählung Wer tanzt schon zu Schostakowitsch von 2000 beschränkt den Schauplatz der Handlung schließlich auf ein Museum und dessen Umgebung, Orte der täglichen Gänge Steiners in Biel. Das Museum ist einer der Gegenräume, die Michel Foucault als Heterotopien bezeichnet hat. Es schließt eine ganze Reihe von Heterotopien ab, durch die Steiner immer wieder Gegenwelten zum Biel seiner Texte erscheinen lässt: Krankenhaus, Haftanstalt, Bordell, Gymnasium, der leere Sockel in Otterwil und vor allem die Gärten des Jahres 1943 in Ein Messer für den ehrlichen Finder mit Blumen, Büschen und Bäumen, an die seine weiteren Texte immer wieder erinnern.
Michael Braun geht den Bezügen zu Gottfried Keller nach, dem Ahnherrn der modernen Schweizer Literatur, die er verstreut in Thomas Hürlimanns Werken findet. Er untersucht diese intertextuelle Relation als ein kontrafaktisches Schreiben, bei dem es weniger auf das ankommt, worauf referiert wird (die Schweiz als Fassadennation, die suburbane Zersplitterung, die metaphysische Obdachlosigkeit, die Verwilderung der Medien), als vielmehr auf den Modus, wie diese Referenzen hergestellt werden: im anekdotischen Framing, in grotesken Spiegelungen, im surrealistischen Setting, in komischen Katastrophen. Es wird gezeigt, wie Hürlimanns Prosasammlung Die Satellitenstadt (1992) im Rekurs auf Kellers Leute von Seldwyla (1855/1874) verwickelte und verwinkelte Vater- und Mutter-Sohn-Geschichten, Heimkehrparabeln und Verhängnis-Novellen vor einer Stadtkulisse mit glücklichem Ende erzählt.
Seit der Antike bevölkern Tiere die Literatur, sei es als moralische Exempel, sei es als wunderliche Tiere, als einfache Begleiter der Menschen bzw. als deren Helfer, als unabhängige Steuer des Geschehens, als hybride Mischwesen zwischen Mensch und Tier, als bedrohliche Geschöpfe usw. In den Fabeln von Äsop und Phaidros sind die Tiere Träger des moralischen Lehrsatzes. Aus der Literatur und im allgemeinen der Kultur des Mittelalters sind Tiere kaum wegzudenken: In der gotischen Architektur wimmelt es von Drachen, Schlangen und Zwittergeschöpfen. In der fürs Mittelalter typischen Gattung des Bestiariums, die auf die spätantike Tradition des Physiologus zurückgeht, findet man neben Darstellungen von wirklich existierenden Tieren – Löwen, Hunden, Elefanten usw. – Beschreibungen von Mischgeschöpfen. Dort, wo in der modernen Literatur Tiere vorkommen, nimmt sie sehr oft auf diese mittelalterliche Gattung Bezug. Berühmt ist im 20. Jahrhundert das unterhaltsame Grosse Bestiarium der Literatur (1923) von Franz Blei.
Bezüglich des Themas der Tiere in der deutschsprachigen Literatur denkt man natürlich in erster Line an Franz Kafka, der verschiedenartige Tiere zu Hauptfiguren seiner Texte machte (Die Verwandlung; Josephine, die Sängerin; Ein Bericht für die Akademie; Der Bau usw.) und sie denken, fühlen und sogar singen ließ. In der deutschsprachigen Schweizer Literatur fehlt es nicht an bedeutsamen, ja an prominenten Beispielen zum Thema ‚Tier im Text’. Mögen Tiere in Albrecht von Hallers Alpen und in Salomon Gessners Idyllen eine recht marginale Rolle spielen, so kommen sie in Johann Heinrich Pestalozzis Fabeln schon in den Überschriften vor (Der grosse Tierkrieg, Der Elefant motiviert sein Urteil). Gottfried Keller zeigt nicht nur in der Novelle Spiegel das Kätzchen, sondern auch in seinen Romanen ein ausgeprägtes Interesse an Tieren. In Der grüne Heinrich beweisen die vom Protagonisten gezüchteten Tiere – er richtet in Kästchen einen Miniaturzoo mit Mäusen, Spinnen, Eidechsen, Schlangen ein –, wie er in einer der Realität entrückten Phantasiewelt lebt – Eidechsen werden von ihm als Krokodile betrachtet –, was verhängnisvolle Folgen hat, denn sobald er sich mit der Realität abfinden muss, vernachlässigt er den Zoo; die Tiere verenden oder sie werden von ihm sogar gequält. In Kellers Desillusionsroman Martin Salander verweist der Umstand, dass der Wald gefällt wird, und die Singvögel verschwinden oder aber gejagt werden, auf eine von den Idealen von 1848 weit abgerückte Gesellschaft, in der das Profitmachen zum herrschenden Prinzip geworden ist. Jeremias Gotthelfs Schwarze Spinne gehört zu den bedeutendsten und aufschlussreichsten Beispielen der theriomorphen Darstellung des Bösen in der Literatur. In Johanna Spyris Heidis Lehr- und Wanderjahre erscheinen die Ziegen als treue Begleiter von Peter und Heidi beinahe auf jeder Seite und bieten Gelegenheit zu einer ökokritischen, sozial- und familiengeschichtlichen Auseinandersetzung. In Joseph Viktor Widmanns in Vergessenheit geratener, singulärer und z. T. rätselhafter Maikäfer-Komödie (1897) nehmen die Maikäfer, die für das Menschenvolk stehen, Abschied von ihren Erdwohnungen. Sobald sie in der oberirdischen Welt sind, müssen sie sich mit den für die Menschen typischen Problemen (Korruption, Ungleichheit, Geschlechtskampf usw.) auseinandersetzen, während sie von den Menschen brutal gequält werden. Heinrich Federer weist in seinen italienischen Reisetexten und -erzählungen eine franziskanische Sicht auf die Tiere auf: In seinem bekanntesten Text Das letzte Stündlein des Papstes wird einem hilfesuchenden Spinnlein der gleiche Status wie dem sterbenden Papst zugeschrieben, demzufolge kann der Protagonist erst zum Sterbebett des Papstes eilen, nachdem er das Insekt gerettet hat. Eine in mancher Hinsicht ähnlich spontane Neigung zu den Tieren entnimmt man der Lyrik Erika Burkarts, in der Tiere und besonders Nacht- und Raubvögel allgegenwärtig sind. Für Robert Walsers Interesse an der Tierwelt sprechen die im Band Der kleine Tierpark (2014) gesammelten Texte, die eine Fundgrube zur Erforschung der Funktion der Tiere in Walsers Oeuvre bilden; außerdem findet man in zahlreichen Mikrogramm-Texten einige aus dem Märchenbereich kommende Tiere, Riesen und Drachen, deren traditionelle Rollen umgewertet werden (z. B. typischerweise in Die Jungfrau. Der Befreier). In Hugo Loetschers Die Fliege und die Tiere und 33 andere Tiere wird mit liebevoller Akribie das Verhalten von Tieren beschrieben, die sich in kaum vorstellbaren, z. T. grotesk wirkenden Situationen befinden. Franz Hohler stellt in seiner zukunftweisenden Novelle Rückeroberung dar, wie die wilden Tiere sich die städtischen Räume wieder aneignen, die sie wegen der Industrialisierung verlassen mussten. In Thomas Hürlimanns Texten sind Katzen zentral für die Sinnkonstitution: in Das Gartenhaus wird eine eigentümliche Tier- und Menschenkonstellation gezeichnet, während in Der grosse Kater der als ‚Kater’ bezeichnete Protagonist sich langsam immer mehr mit dem geschundenen Körper eines Kätzchens identifiziert. In Lukas Bärfuss’ Koala steht das Titeltier im Mittelpunkt der verblüffenden Binnengeschichte, in der in einer fachwissenschaftlichen Sprache die Lebensgewohnheiten des Koalabären geschildert und Parallelen zu dem als ‚Koala’ genannten verstorbenen Protagonisten, nämlich des Bruders des Erzählers, suggeriert werden. Im Zentrum des im Milieu der Gentechniker spielenden Romans Der Elefant von Martin Suter steht eine zum Motor für die bewegte Handlung fungierende leuchtende Elefantenkuh mit wundersamen Eigenschaften, eine Figur, die zur bioethisch-philosophischen Auseinandersetzung mit der Genmanipulation anregt. Das Stichwort ‚Tier im Text’ findet auch bei der jüngeren Generation von Autorinnen and Autoren ein bemerkenswertes Echo. Es sei hier nur ein Beispiel unter vielen erwähnt, nämlich der magisch-phantastisch anmutende und von eigentümlichen Geschöpfen bevölkerte Debütoman von Michelle Steinbeck Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch (2016). Die Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart demonstriert sehr überzeugend, wie die traditionelle Tierfabel bzw. -dichtung von neuen Formen überlagert wird: Hanna Johansen hat eine besondere Vorliebe für Tiere, u. a. für Katzen, verschiedene Vogelarten, Fische und Bären; Lorenz Pauli bietet im erfolgreichen, bereits in viele Sprachen übersetzen Buch Rigo und Rosa (2016) fabelartige Geschichten, in denen ein Leopard und eine Maus auf ironisch-humorvolle Weise über Gefühle und Lebenswahrheiten sprechen und gängige Denkmuster in Frage stellen.
Im Aufsatz von Joanna Nowotny wird die Funktion der vielen Tierfiguren, -vergleiche und -bilder in Adelheid Duvanels Text- und Bildwerk untersucht. Wie Nowotny darlegt, kann man drei verschiedene Facetten von Duvanels Schreiben von und mit Tieren unterscheiden: Zuerst stehen die Fabel-Variationen zur Debatte, die Duvanel in den frühen Sechzigern publizierte. In ihnen macht sie die fundamentale Fremdheit zwischen Lebewesen zum Thema, auch und gerade dann, wenn Tiere auf einer formalen und einer inhaltlichen Ebene vermenschlicht werden. Zweitens entwickelt Duvanel anhand von Haustieren positive Visionen eines Umgangs mit Alterität – ironischerweise werden die ‚schrägen Vögel’ dieser Texte menschlicher behandelt als Duvanels menschliche Figuren, die nicht der Norm entsprechen. Hier geht Nowotny auf die noch kaum bekannten Tierkolumnen ein, die Duvanel in den siebziger Jahren für die Basler Zeitung „Doppelstab” verfasste. Weiterhin analysiert Nowotny, wie Duvanel auf der Bild- und Vergleichsebene Menschen, Tiere und Naturkräfte vermengt, mit zentralen Weiterungen für die Erzähl- und Darstellungsperspektive sowie für den Handlungsspielraum der Figuren im Werk. Aus der Auflösung von Grenzen – zwischen Lebewesen, Lebewesen und Objekten, Menschen und Tieren, Naturkräften und Tieren – resultiert die ontologische Verunsicherung, durch die Duvanels Figuren und Texte geprägt sind.
In Ulrich Webers Analyse der Rolle der Vögel im Werk des Schriftstellers und Psychiaters Walter Vogt unter Einbezug des Nachlasses im Schweizerischen Literaturarchiv wird die Beziehung zwischen persönlichem Interesse und literarischer Praxis beleuchtet. Vogts Werke sind bekanntlich stark von seinen biografischen Erfahrungen als Röntgenarzt und Psychiater geprägt, doch spiegeln sie ebenfalls sein lebenslanges Interesse an der Ornithologie wider. Weber führt Vogts anfängliche Beobachtungen von Vögeln in der Kindheit und seine beachtenswerten ornithologischen Publikationen in der Jugend aus und verfolgt anschließend die Frage, wie sich diese Kenntnisse im literarischen Werk ausdrücken und welche literarische Funktion sie übernehmen.
Ein zentrales Anliegen Vogts beim Einbezug von Vögeln in sein Werk scheint die kritische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Verhältnis zur Natur, insbesondere der Bedrohung durch Pestizide und den allgemeinen Zivilisationsdruck. Besonders hervorzuheben sind etwa die satirischen Elemente, die Vogt in Geschichten wie Diät und Ornizid verwendet, um den kurzsichtigen und zerstörerischen Umgang mit Umweltgiften anzuprangern. Daneben thematisiert Webers Untersuchung die Verbindung von Wissen und Wahn in Vogts Texten wie Der Vogel auf dem Tisch und Die roten Tiere von Tsavo, wobei der vordergründig kranke psychische Zustand der Protagonisten im Zeichen der ‚Dialektik der Aufklärung’ einer Spiegelung von Wissen und Wahn Raum gibt.
Schließlich wird die Topik der Vögel insbesondere im Roman Altern mit seiner Auflösung der Grenzen zwischen Mensch und Natur als eine frühe Reflexion im Zeichen des aktuellen Diskurses des „animal turn” verstanden. Webers Analyse verdeutlicht, dass Vogts literarisches Schaffen eine Synthese aus persönlicher Passion, wissenschaftlicher Akribie, literarischem Spiel und Zivilisationskritik darstellt, die es ermöglicht, komplexe Zusammenhänge zwischen Mensch, Tier und Umwelt zu erfassen.
An einen in Vergessenheit geratenen Intellektuellen Harry Gmür, sein politisches und kulturelles Engagement und literarisches Schaffen erinnert Ewa Mazurkiewicz in ihrem Beitrag Harry Gmür – ein Autor im Verborgenen. Ihrer Darstellung folgt ein kurzer Text von Gmür Im Königspalast aus der Sammlung Reportagen von links. Vier Jahrzehnte Kampf gegen Faschismus und Kolonialismus. Natalia Czudek berichtet kurz über eine Tagung zum Thema „Die Beziehung der Deutschschweizer Literatur zu den Klassikern”, die in den Tagen vom 2. bis 4.10.2024 an der Università degli Studi di Roma Tor Vergata im Tagungszentrum Villa Mondragone von Anna Fattori organisiert wurde.
Die Herausgeber
Dariusz Komorowski, Anna Fattori, Ján Jambor