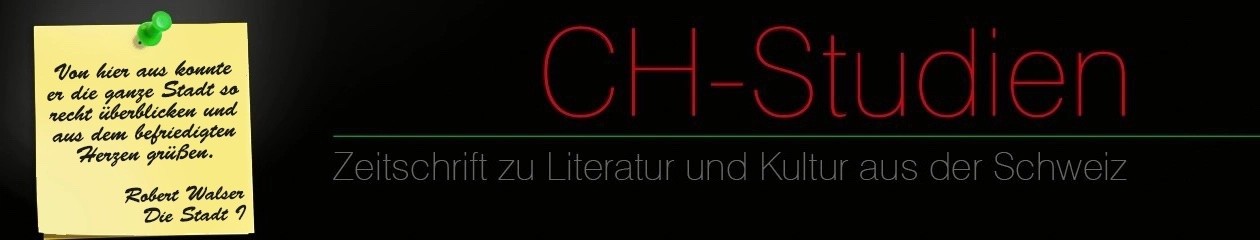Daniel Rothenbühler, Hochschule der Künste Bern
In fast allen seinen Werken hat Jörg Steiner seine Heimatstadt Biel auf die eine oder andere Weise zum Bezugspunkt seines Erzählens gemacht. Ausnahmen bilden einzelne Erzählungen und sein letztes Buch Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean. Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, was sich in dem fortdauernden Bezug auf Biel über das literarische Schaffen dieses Autors offenbaren könnte. Wie die meisten Autoren seiner Generation aus der deutschsprachigen Schweiz lehnte er es ab, sich und seine Lesenden durch die Exotik ferner Orte von „der eigenen Unruhe“ ablenken zu wollen. Seine Bezugnahme auf tatsächliche Straßen, Plätze, Gebäude und Gärten Biels lässt er aber immer vom Zweifel am Realitätsgehalt seiner Angaben begleiten. Im Prosaerstling Eine Stunde vor Schlaf transformiert er seine Heimatstadt in ein imaginäres Grub, das nur in der Gesamtsicht auf Stadt und Landschaft an Biel erinnert. In den Romanen Strafarbeit und Ein Messer für den ehrlichen Finder hingegen heißt die dargestellte Stadt Biel, lässt sich aber nur durch eine Vielzahl von Teilansichten als diese erkennen. Hier wie in den weiteren Texten, die Steiner von Anfang der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre veröffentlichte, steht der forcierte Bau von Straßen und Hochhäusern paradigmatisch für eine Entwicklung der Schweiz, deren Städte in den 1950er bis 1970er Jahren auch ohne die großen Kriegszerstörungen ihrer Nachbarländer einen radikalen topographischen Wandel erfuhren. Mit dem Erzählband Olduvai von 1985 nimmt Steiner dann Abschied von Biel als Industriestadt im ständigen Umbau. Der Roman Weissenbach und die anderen von 1994 zeigt mit dem fingierten Otterwil, wie die Notabeln einer postindustriellen Kleinstadt auf die großen ökonomischen und politischen Umwälzungen der beginnenden Globalisierung reagieren. Im Zentrum der Stadt steht ein leerer Sockel als Denkmal auf alle vergangenen Denkmäler. In deutlichem Gegensatz dazu folgt die Erzählung Der Kollege dann 1996 dem Gang eines arbeits- und erwerbslosen Außenseiters durch eine Stadt ohne Mitte, die bis in die Einzelheiten als Biel erkennbar ist und den Lesenden trotzdem so fremd vorkommt wie die Randzone einer Metropole. Die Erzählung Wer tanzt schon zu Schostakowitsch von 2000 beschränkt den Schauplatz der Handlung schließlich auf ein Museum und dessen Umgebung, Orte der täglichen Gänge Steiners in Biel. Das Museum ist einer der Gegenräume, die Michel Foucault als Heterotopien bezeichnet hat. Es schließt eine ganze Reihe von Heterotopien ab, durch die Steiner immer wieder Gegenwelten zum Biel seiner Texte erscheinen lässt: Krankenhaus, Haftanstalt, Bordell, Gymnasium, der leere Sockel in Otterwil und vor allem die Gärten des Jahres 1943 in Ein Messer für den ehrlichen Finder mit Blumen, Büschen und Bäumen, an die seine weiteren Texte immer wieder erinnern.
Schlüsselwörter
Aktionsraum, Alessandro Manzoni, Anschauungsraum, Bautätigkeit, Biel, Bruno Latour, Cesare Pavese, Daniel Weber, Denkmal, empirischer Leser, Erzählinstanz, Erzählverhalten, Geographie, Georaum, Grad der Referentialität, Heimatstadt, Heterotopie, Jurasüdfuß, kritischer Regionalismus, Landkarten, Marginalität, Modell-Leser, Oligooptik, Panoptik, Panorama, Paradox, Paris, Paul Nizon, Peter Bichsel, Realitätseffekt, Roland Barthes, Rom, Sanierung, Heinz Schafroth, Schriftsteller, Städtebautheorie, Stadtplanung, Stadttopographie, Straßenbau, Textraum, Umberto EcoInevitably recurring: The topography of the city of Biel in Jörg Steiner’s complete works
In almost all of his works, Jörg Steiner has made his hometown of Biel the point of reference for his stories in various ways. Exceptions are a few short stories and his last book Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean. The present study explores the question of what might be revealed about the author’s literary oeuvre in his continuing reference to Biel. Like most authors of his generation from German-speaking Switzerland, he refused to distract himself and his readers from “their own restlessness” with the exoticism of distant places. However, his references to actual streets, squares, buildings and gardens in Biel are always accompanied by doubts about the realism of his descriptions. In his prose work Eine Stunde vor Schlaf, he transforms his hometown into an imaginary Grub, which is only reminiscent of Biel in a overall view of the city and landscape. By contrast, in the novels Strafarbeit and Ein Messer für den ehrlichen Finder, the city depicted is called Biel, but can only be recognized as such through a multitude of partial views. Here, as in the other texts that Steiner published from the early 1960s to the mid-1980s, the forced construction of streets and high-rise buildings is paradigmatic of a development in Switzerland, whose cities underwent radical topographical change in the 1950s to 1970s, even without the major war destructions of its neighboring countries. With Olduvai, the 1985 collection of stories, Steiner then bids farewell to Biel as an industrial city under constant reconstruction. The 1994 novel Weissenbach und die anderen uses the fictitious Otterwil to show how the notables of a post-industrial small town react to the major economic and political upheavals of the onset of globalization. An empty pedestal stands in the center of the town as a monument to all past monuments. In clear contrast to this, the story Der Kollege in 1996 follows the journey of an unemployed and unemployable outsider through a town without a center, which is recognizable as Biel down to the last detail and at the same time seems as foreign to the reader as the outskirts of a metropolis. The story Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch from 2000 finally limits the setting of the plot on a museum and its surroundings, places of Steiner’s daily walks in Biel. The museum is one of the counter-spaces that Michel Foucault described as heterotopias. It completes a whole series of heterotopias through which Steiner repeatedly creates counter-worlds to the Biel of his texts: Hospital, prison, brothel, grammar school, the empty pedestal in Otterwil and, above all, the gardens of 1943 in Ein Messer für den ehrlichen Finder with the flowers, bushes and trees that his other texts repeatedly remind us of.
Keywords
action space, Alessandro Manzoni, Biel, Bruno Latour, building activity, Cesare Pavese, critical regionalism, Daniel Weber, degree of referentiality, empirical reader, geography, geo-space, heterotopia, hometown, maps, marginality, model reader, monument, narrative attitude, narrative instance, oligooptics, panoptics, panorama, paradox, Paris, Paul Nizon, Peter Bichsel, reality effect, redevelopment, road construction, Roland Barthes, Rome, Heinz Schafroth, southern foot of the Jura, text space, Umberto Eco, urban development theory, urban planning, urban topography, viewing space, writer
Verlebendigung in der „eigenen Unruhe“
Als „unvermeidlich wiederkehrenden Ort“1 in Jörg Steiners Erzählen hat Heinz Schafroth, der wohl beste Kenner der Werke dieses Autors, Biel, dessen Heimatstadt 1998 bezeichnet. Das bestätigte Steiner zwei Jahre später noch einmal mit Wer tanzt schon zu Schostakowitsch. Erst in seinem letzten Buch, Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean, hat er dann 2008 zum ersten Mal in einem größeren Prosatext Abstand von Biel genommen und Kalifornien zum Ort seines Erzählens gemacht. Vereinzelt hatte er sich zwar zuvor schon in verschiedenen Erzählungen von Biel entfernt, in Olduvai etwa, dem bekanntesten Beispiel dieses Ortwechsels. Auffällig ist aber, dass er Biel ab Eine Stunde vor Schlaf, seiner ersten Erzählung von 1958, in der Mehrzahl seiner Prosawerke und vor allem in drei Romanen immer zum mehr oder weniger offensichtlichen Bezugspunkt seines Erzählens machte. Dabei schöpfte er das ganze Spektrum im “Grad der Referentialität“2 zwischen dem „Textraum“ seiner Erzählprosa und dem „Georaum“3 seiner Heimatstadt aus. In Eine Stunde vor Schlaf gehört Biel, wenn man der Typologie von Barbara Piatti folgt, zu den „fiktionalisierten Städten“4, denn hier nennt Steiner seine Heimatstadt Grub und macht sie dennoch „anhand der geschilderten Lokalitäten als […] Biel identifizierbar“5. In den Romanen Strafarbeit (1962), Ein Messer für den ehrlichen Finder (1966) und Das Netz zerreißen (1982) und in den beiden Erzählungen Der Kollege (1996) und Wer tanzt schon zu Schostakowitsch (2000) stellt er – wie auch schon in vielen kleineren Erzählungen – durch die Nennung der Stadt oder einzelner Straßen, Gebäude und Einrichtungen eine ausdrückliche Referenz auf das reale Biel her. Eine bedeutungsvolle Ausnahme bildet der Roman Weissenbach und die anderen von 1994, in dem Steiner mit Otterwil einen „fingierten Schauplatz“6 schafft, eine imaginäre Stadt, die zwar einzelne Merkmale mit Biel teilt, aber viele auch mit Bern oder anderen Städten.
Wie hoch oder tief der Grad der Referentialität auch jeweils sein mochte, die Konstanz, mit der Steiner eine mittelgroße Stadt der Schweiz in seinen Texten immer wieder als Biel kenntlich machte, gibt zur Frage Anlass, was sich darin über sein gesamtes literarisches Schaffen offenbaren könnte. Denn dass Biel zum „unvermeidlich wiederkehrenden Ort“ in Steiners Werken geworden ist, lässt sich nicht einfach dadurch erklären, dass er in dieser Stadt geboren wurde, dort aufwuchs und als Schriftsteller von 1956 bis zu seinem Tod „57 Jahre lang im gleichen Haus, in der gleichen Wohnung“7 wohnte. Schafroth betont zu Recht, dass die Biografie Steiners ihn ja zugleich „als durchaus weitgereist“8 ausweist, und stellt klar: „Aber die literarischen Früchte der Reisen sind selten und karg. Zu Literatur verarbeitet, ist sein Ausland (Afrika, Spanien, Frankreich) auf Distanz gehalten und bekommt keine Gelegenheit, sich poetisch aufzuspielen.“9
Dass Steiner den Schauplätzen ebenso wenig wie den Figuren und Geschichten seiner Texte die Gelegenheit gab, sich „poetisch aufzuspielen“, ist nach Schafroth ein Grundzug seines Erzählens. Die Funktion der Literatur bestehe für Steiner darin, dass sie sich „den Abbau der Träume zum Ziel zu setzen habe“10 schrieb Schafroth 1979 im Nachwort zur Erzählsammlung Eine Giraffe könnte es gewesen sein. Warum aber soll der Abbau der Träume in Texten eher vonstatten gehen, in denen der Autor statt ferner Gegenden den eigenen Geburts- und Wohnort zum Schauplatz seiner Geschichten macht? Eine mögliche Antwort gibt Steiner in der Erzählung Eine Anleitung zum Handeln im Erzählband Auf dem Berge Sinai sitzt der Schneider Kikeriki von 1969. Eine literarisch schreibende Studentin in „einer schöpferischen Krise“ (W 3,4011) fragt dort ihren Freund: „Wie komme ich zu einer Geschichte?“ und: „Wie komme ich über eine Geschichte hinaus?“ (W 3, 39) Am einfachsten könne eine Boulevardzeitung es sich mit ihren Geschichten machen, meint sie: „Es sind Geschichten von außerordentlichen oder schrecklichen Ereignissen, Rekordgeschichten; Geschichten, die den Leser erregen und ihn gleichzeitig in eine falsche Sicherheit wiegen.“ (W 3, 39) Ihr Freund sieht das auch so: „Sie schreiben von Rassenkrawallen in Amerika, um die Leser von der eigenen Unruhe abzulenken. Ablenkung von der eigenen Unruhe ist das Wichtigste.“ (W 3, 41) Offenbar ist diese Ablenkung eher in Geschichten möglich, die in der Ferne spielen, während Schreibende ebenso wie Lesende sich zu größerer Achtsamkeit auf die eigene Unruhe angehalten sehen, wenn das, was sie schreiben oder lesen, sich am Ort ihrer eigenen Erfahrungen ereignet.
In der Besprechung eines Buches seines Freundes Franz Hessel hat Walter Benjamin 1929 zwei Sorten von Städteschilderungen unterschieden:
Wenn man alle Städteschilderungen, die es gibt, nach dem Geburtsorte der Verfasser in zwei Gruppen teilen wollte, dann würde sich bestimmt herausstellen, dass die von Einheimischen verfassten sehr in der Minderzahl sind. Der oberflächliche Anlass, das Exotische, Pittoreske, wirkt nur auf Fremde. Als Einheimischer zum Bild einer Stadt zu kommen, erfordert andere, tiefere Motive. Motive dessen, der ins Vergangene statt ins Ferne reist.12
Auch wenn Städteschilderungen nicht im Zentrum seiner Texte stehen, würde Steiner in seinem Verzicht auf „das Exotische, Pittoreske“ und in der fortgesetzten Bezugnahme seiner Texte auf seine Heimatstadt in Benjamins Typologie zweifellos den zweiten Typus verkörpern. Das Gegenstück in der Literatur der deutschsprachigen Schweiz wäre in seinem Zeitgenossen Paul Nizon zu finden. Schafroth stellt die beiden Autoren im schon zitierten Aufsatz von 1998 denn auch einander gegenüber und zeigt, wie Nizon „aus dem Ausbruch aus der schweizerischen Enge ein Lebens-, aber auch ein literarisches Programm gemacht“13 hat und dass dieser Ausbruch „ihm nur als einer in die Kapitalen denkbar ist: Rom zuerst (‚Canto‘), danach (und vermutlich definitiv) Paris (‚Das Jahr der Liebe‘).“14 Zugleich betont er, es sei „nicht das erlebte Rom, das [Nizon] zum Schriftsteller werden lässt. Sondern das ,Andere Land‘, ,das Ding, das nicht Rom ist‘ und das ihn nicht an sich herankommen ließ, solange es Erfahrung war“15. Demgegenüber zeigt Schafroth bei Steiner auf, wie sehr dieser sich immer wieder an das erlebte Biel, seine Heimatstadt, halte, betont aber auch, dass es ihm dabei nicht einfach um größere Nähe zur Wirklichkeit gehe, sondern um die Unausweichlichkeit der eigenen Unruhe:
Weil die Realität der Namen und Bezeichnungen ohnehin nicht nachweisbar, alles Statistische sogleich überholt und das Ereignishafte bald einmal vergessen ist, können sich kaum je Vertrautheitsgefühle oder Erinnerungsfreude breitmachen. Auch der Steiner-Leser ist in fremdes Land geraten und findet sich dort in guter Gesellschaft wieder: derjenigen von Steiners literarischem Personal und der des Autors selber.16
Dieses „Fremdsein auch in der nahen und nächsten Welt“17 stellt sich in Steiners Texten dank der Bruchstückhaftigkeit seines Erzählens her, einer Bruchstückhaftigkeit gerade auch in der Bezugnahme auf die an sich vertraute Stadttopographie. Denn bei Steiner wird selbst die nächste und vertrauteste Wirklichkeit
erfahren als etwas heillos Zerbrochenes und Fragmentarisches. Der Schriftsteller könnte versuchen, sich und dem Leser ein Ganzes zurechtzuerfinden. Steiner (wie Walser) sieht seine Aufgabe darin, Brüche und Bruchstückhaftigkeit als solche sichtbar werden zu lassen und zugleich seiner Ahnung Ausdruck zu geben, dass jedes einzelne dieser Wirklichkeitsfragmente eine Unzahl anderer neben sich hat und sie alle zusammen eine nicht mehr herstellbare Ganzheit ergeben würden.18
Dieses Beharren
auf der Bruchstückhaftigkeit der Wirklichkeit ist ein Beharren auf ihrer Lebendigkeit. Schreiben in all seiner Behelfsmäßigkeit und Anfälligkeit ist dann schließlich ein Anschreiben gegen das Vergreisen, Gerinnen, Erkalten.19
Demgegenüber sucht Nizon in Rom und Paris gemäß Sigrid Weigel die „Verlebendigung des männlichen Ich-Erzählers in seiner Furcht vor dem Absterben, dem er auch schreibend entgegenzuwirken sucht“, im Ausleben „seine[r] Lust- und Angstwünsche, die sich wechselweise auf Frau und Stadt richten.“20 Gemeinsam ist den beiden gegensätzlichen Autoren, was Weigel eine „Verlebendigung“ nennt, bei Nizon jene der eigenen Person bzw. Autorschaft, bei Steiner die dargestellte Wirklichkeit, in der die „eigene Unruhe“ in einem bruchstückhaften Schreiben zum Vorschein kommt.
Das Bedürfnis zum „Anschreiben gegen das Vergreisen, Gerinnen, Erkalten“ wurde bei Nizon, Steiner und weiteren Autoren ihrer Generation in der Schweiz durch gesellschaftliche Verhältnisse geweckt, die sie als Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 1935 und 1955 aufgrund der geistigen Landesverteidigung der Schweiz und ihrer Fortsetzung im Kalten Krieg als einengend und lähmend erlebt hatten. Daniel Weber zitiert dazu in seiner Monographie zu Steiners Werk von 1988 die Literaturkritikerin Elsbeth Pulver. Diese hält für die ganze Autorengeneration, die „zwischen 1921 (Geburtsjahr von Dürrenmatt und Kurt Marti) und 1935 (Geburtsjahr von Peter Bichsel) geboren wurde“ und Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre hervortrat, fest, dass sie sich „von den überlieferten Werten“ ablösen musste, „um einen eigenständigen literarischen Ausdruck zu finden.“21 Während Nizon diese Ablösung im Wegzug in die Metropolen Rom und Paris und dort in der ästhetischen Befreiung suchte, sind die meisten anderen Vertreter dieser Autorengeneration der deutschsprachigen Schweiz in ihrer angestammten Region geblieben, sowohl in ihrem Leben wie in ihren Texten, und haben im Bruch mit dem herkömmlichen Regionalismus eine kritische „Auseinandersetzung mit dem unmittelbaren Lebensraum“22 und dessen Geschichte entwickelt. Zu den Vertretern dieses neuen, kritischen Regionalismus gehörten neben Steiner auch Otto F. Walter, Gerhard Meier und Peter Bichsel, alle vier wurden im deutschen Sprachraum als „Jurasüdfuß-Autoren“ bekannt23. Für „jeden einzelnen“ von ihnen, betont Daniel Weber, sei die Region der Brennpunkt geworden, „in dem Überregionales erfahrbar wird, nicht Fluchtpunkt, in dem es sich verliert.“24
„In Wirklichkeit“ nicht sicher, „wie es wirklich ist“
Wenn hier nun in einzelnen Texten Steiners untersucht werden soll, wie ihre an Biel orientierten Stadttopographien im Regionalen das Überregionale und in der Sesshaftigkeit die Unruhe offenbaren, wird es nicht in erster Linie darum gehen, die jeweilige Übereinstimmung des „Textraums“ mit dem „Georaum“ zu überprüfen. Zwar verlangt die Analyse der Spannung zwischen Vertrautheit und Fremdheit in den literarischen Stadttopographien dieser Texte, dass der manchmal „übergenaue[n] Bestandesaufnahme an Ort“25 nachgegangen wird. Aber das damit allenfalls verbundene Studium der beigezogenen Karten, Stadtpläne oder Namensverzeichnisse läuft nicht auf die Prüfung der Wirklichkeitsnähe dieser Stadttopographien hinaus, sondern auf die Würdigung und Deutung der sich aus ihnen ergebenden Geschichten.
Der Text In der Nacht im Erzählband Olduvai von 1985, dessen Handlung offensichtlich in Biel spielt, zeigt einen Mann, der – wie fast täglich auch der Autor – eine Allee entlanggeht, und präzisiert:
Der Mann würde nicht beschwören wollen, dass am Ende der Allee ein See liegt. Auf der Landkarte ist er eingetragen, als Bielersee. Landkarten sind Steckbriefe zur Kenntlichmachung; aber in Wirklichkeit ist hier alles so, dass keiner sicher sein kann, wie es wirklich ist. […] Dem Mann, der durch die Allee geht, kommt es beim Gehen so vor, als sei seine Welt brüchig, von Krisen gefährdet, ins Unsichere gebaut. (W 3, 255-256)
Das Paradox, wonach man gerade „in Wirklichkeit“ nicht sicher sein kann, „wie es wirklich ist“, löst sich auf, wenn man das „hier“ als den Text selbst versteht und nicht als das reale Biel. Landkarten verleiten zur geographischen und topographischen „Kenntlichmachung“, doch im literarischen Text geht es um etwas Anderes. Worum, das legte Steiner zehn Jahre später in einem kurzen Essay dar, der im Supplement der Weltwoche veröffentlicht wurde. Unter dem Titel Die Landschaft des Lesers führt er aus, er habe sich in der Schule nie in der Weise für Landkarten interessiert, wie sein Geographielehrer das gewünscht hätte. Dieser hatte „nichts übrig für Geschichten“ (W4, 342), während Steiner sich durch Landkarten immer dann angesprochen fühlte, wenn sich in ihnen eine Geschichte offenbarte. Er zeigt dies am Beispiel des kleinen Flüsschens Belbo, das im Roman La luna e i falò (1950) – deutsch Junger Mond (1954) bzw. Der Mond und die Feuer (2018) – durch die Heimatstadt des Protagonisten fließt, in die dieser zurückkehrt, um sich in der Suche nach der Vergangenheit seiner Identität zu versichern. Der Belbo, in Wirklichkeit ein kleines, „im Herbst nur wenig Wasser führendes Flüsschen“, wälzt sich für Steiner als Pavese-Leser wie „Joseph Conrads Kongo oder William Faulkners Mississippi dem Meer entgegen, sanft und gewalttätig, lebensspendend und lebenvernichtend“ (W4, 343), und es stört ihn nicht, dass die kartographierte
Wirklichkeit der Geographie nicht mit der Wirklichkeit der Geschichte übereinstimmt; denn nur im Spiegelbild der Geschichte erkenne ich den Belbo, der mich teilnehmen lässt an dem durch Paveses Erzählung überlieferten, erfundenen und beglaubigten Schicksal anderer Menschen. (W4, 343)
Und dennoch bleibt der Bezug auf den kartographierten Belbo unverzichtbar. Steiner könnte in Abwandlung eines poetologischen Diktums seine Freundes Peter Bichsel sagen, dass für seine Pavese-Lektüre zwar nicht der reale Belbo das Thema ist, sondern das Verhältnis zu ihm26 , dieses aber nur in der Bezugnahme auf ihn zu fassen ist, auch wenn es weit über den Belbo der Geographie hinausweist. Eine weitere jener Paradoxien, die Steiners Schreiben immer wieder kennzeichnen.
Geordnete Gesamtheit im Panorama
In Steiners Prosaerstlings Eine Stunde vor Schlaf ist das Krankenhaus einer Provinzstadt Schauplatz des Geschehens. Die Stadt heißt Grub. Mit dieser Benennung trifft der Autor zwar eine Unterscheidung zu seiner Heimatstadt Biel, er schafft insofern aber zugleich auch eine Verbindung zu ihr, als der Name Grub als Umdrehung des Namens Biel betrachtet werden kann. Lange Zeit wurde der Name „Biel“ nämlich auf das althochdeutsche buhil bzw. mittelhochdeutsche bühel, also „Hügel“, zurückgeführt, was insofern überzeugend schien, als das mittelalterliche Biel, wie auch die heutige Altstadt bezeugt, auf einer kleinen Anhöhe lag27. In der Umkehrung von Biel zu Grub erscheint die Stadt der Erzählung also konsequenterweise nicht auf einer Erhebung, sondern in der Tiefe, im Blick vom Berghang oben gesehen, an dem das Krankenhaus liegt. Die Lage oberhalb der Stadt, zu der dieses gehört, hat das Krankenhaus im Text mit dem einstigen Bezirksspital und heutigen Spitalzentrum Biel gemein. Steiner lässt in der Erzählung Patienten, Angehörige, Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, Hilfskrankenwärter und Küchenpersonal auftreten und sie das Krankenhaus aus verschiedenen Perspektiven erleben. Als zentrale Figur erweist sich zum Schluss hin der Hausbursche Po-Pol. Er begegnet im Operationssaal dem Instruktionsoffizier Kuhne, der einst bei der gemeinsamen militärischen Ausbildung einen Unfall herbeigeführt hat, in dessen Folge Po-Pol für sein ganzes Leben durch einen zerschlagenen Kiefer und eine breiige Stimme gekennzeichnet blieb. Kuhne wird nun nach einem schweren Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert und kann nur durch eine Notoperation gerettet werden, für die eine Blutspende nötig wäre. Diese wird zum Schluss ausgerechnet Po-Pol leisten.
Daniel Weber findet in dieser ersten Erzählung Steiners schon mehrere Merkmale, die dessen ganze weitere Erzählprosa prägen werden: einen „Hang zur Reflexion“28, auf das Erzählen bezogen, während die Figuren und Geschehnisse von der „analytische[n] Durchdringung“29 bewahrt werden; den Verzicht auf „einen geradlinigen Handlungsverlauf“30; einen Ablauf der Zeit, „[s]prunghaft, stockend, mal fast stillstehend, dann wieder beschleunigt, gerafft“31 ; eine Dramaturgie schließlich, die sich „nicht zielstrebig auf Spannungsmomente hin“32 entwickelt, so dass die Geschichte „statt einer Zuspitzung […] eine Auffächerung“33 in verschiedene Figuren, Handlungen und Orte erfährt. Das betrifft insbesondere das Krankenhaus, das durch eine fragmentierte Topographie gekennzeichnet ist, so wie in späteren Texten die Städte, die sich auf Biel beziehen.
Im Unterschied zu diesen späteren Texten fällt in Eine Stunde vor Schlaf auf, dass hier mit der Stadt gerade das Gegenteil einer Auffächerung geschieht: Während der Text uns die Außen- und vor allem Innenräume des Krankenhauses in mehrfachen Perspektiven sehen lässt, erscheint Grub in einer Panoramaansicht als ein geschlossenes Ganzes. Bedeutsam wird dies insofern, als die Erzählung auf dieser Gesamtansicht gleich dreimal insistiert. Das erste Mal auf einer der Busfahrt im Aufstieg zum Krankenhaus, das auf einer Anhöhe über der Stadt liegt:
Es legen sich jetzt einige scharfe Kurven in den Berg, und wenn man wieder hinausschaut, hinunter, ist das, was man von der Stadt sieht, umfassender geworden, Land beginnt hinter den Vorortflecken, ein Fluss, ein See, das Gebirge, eine Hügelreihe; aber die Häuser schrumpfen zusammen, Einzelheiten gehen verloren, Unterschiede: großes Haus, Hütte, Kirche wirken nur noch als Bewegungen. (W4, 168)
Das zweite Mal, immer noch auf der Busfahrt, aber nun von der Anhöhe oben:
man ist jetzt schon hoch über der Stadt, man sieht über dem Häusergewirr einen bläulichen Dunst hängen, Himmel, Land, einen blitzenden Fluss, Kühles, Warmes, Beruhigtes und Wildes und die Farben, die je nach Jahreszeit deutlich werden oder vergilben. (W4, 169)
Das dritte Mal schließlich aus dem Krankenhaus selbst:
Vor den Fenstern ist der Himmel dunkler geworden, tief graublau, und wenn man die Vorhänge zieht, sieht man die ganze Stadt, ein leuchtendes Geschmeide aus Lichtern, unter sich, man sieht die Hügel ansteigen, die Straßen, Linien, die immer wieder von andern zerschnitten werden […].“ (W4, 175)
Im dreifachen Blick von oben, in dem die Häuser zusammenschrumpfen, sich dann als „Häusergewirr“ darbieten und schließlich ein „leuchtendes Geschmeide aus Lichtern“ bilden, erscheint die Stadt in zweifacher Weise mit dem Krankenhaus kontrastiert: Sie bleibt Anschauungsraum34 gegenüber dem Aktionsraum des Krankenhauses35 und erscheint im Panorama zum vornherein als geordnete Gesamtheit, während sich im Krankenhaus erst durch bestimmte Handlungen der Figuren – wie die Blutspende für Kuhne, zu der Po-Pol sich zum Schluss durchringen kann – etwas Gemeinsames ergeben kam. Sonst werden uns die Krankenhausräume immer nur in der unterschiedlichen Ansicht der einzelnen Figuren oder eines unpersönlichen „man“ bzw. „wir“ gezeigt. Wir sehen sie so wie „die Besucher, die Kranken, die Gesunden, die Ärzte, die Schwestern. Wir begnügen uns mit der Ansicht, die die Dinge uns bieten“ (W4, 157), stellt der Text fest, man sieht „immer nur die Perspektiven des Raums, worin man sich selber aufhält“ (W4,158).
Der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour hat eine solche fragmentierte Sicht auf den Raum als „Oligooptik“ bezeichnet: „Von Oligooptiken aus sind robuste, aber extrem schmale Ansichten des (verbundenen) Ganzen möglich – solange die Verbindungen halten.“36 Das Ganze einer Institution (wie hier des Krankenhauses) oder einer Stadt wird in der Oligooptik nicht durch eine Gesamtansicht als gegeben unterstellt, sondern durch eine Vielzahl von Ansichten als eine durch deren Komposition erst zu realisierende Möglichkeit dargestellt:
Oligooptiken sind genau solche Orte, denn sie leisten das genaue Gegenteil von Panoptiken: Sie sehen ganz eindeutig zu wenig, um den Größenwahn des Inspektors oder die Paranoia des Inspizierten zu nähren, doch was sie sehen, sehen sie gut – daher die Verwendung dieses griechischen Worts, mit dem auch ein Ingredienz [sic!] bezeichnet wird, das gleichzeitig unerlässlich ist und in winzigen Mengen vorkommt.37
Panoptiken bzw. Panoramen, so Latour, „sammeln, sie rahmen, sie reihen, sie ordnen, sie organisieren“38, Oligooptiken hingegen stellen sich „der sehr viel schwierigeren politischen Aufgabe […], die darin besteht, die gemeinsame Welt allmählich zusammenzusetzen.“ 39
Steiner wird dieser Aufgabe in den Stadttopographien der Texte, die er nach Eine Stunde vor Schlaf schreibt, soweit sie mehr oder weniger deutlich an Biel erinnern, fortlaufend dadurch Rechnung tragen, dass er ihnen die Möglichkeit vorenthält, sich – nach Schafroth – „poetisch aufzuspielen“, wie dies der dreifache Panoramablick auf die Stadt dieser in der ersten Erzählung noch ermöglicht. Das Netz zerreißen, sein dritter Roman, greift diesen Panoramablick noch einmal auf, nun aber verbunden mit einer Reflexion, die als Kritik daran gedeutet werden kann. Robert Knecht, der Protagonist des Romans, geht jeweils zu Fuß den Berg hinauf, um seinen Freund Sugus im Krankenhaus zu besuchen:
Wer über Treppen und Waldwege das Spital erreichte, bog, nachdem er das Angestelltenhaus hinter sicher gelassen hatte, in eine gepflasterte Straße ein, kam durch eine Baumgruppe, Kiefern, blieb vorn an der Mauer stehen, sah auf die Stadt hinunter, dann zu den Rebgärten hinüber, die sich in Terrassen dem nach Westen abfallenden Jurakamm entgegenschwangen und an ihrer Grundlinie vom See aufgefangen wurden. […] Es war die Aussicht, die auch die Sterbenden hatten, die Genesenden, die Unheilbaren […].“ (W2, 249)
Der Panoramablick auf die ganze Stadt als Teil einer Landschaft mag ein schönes Bild bieten, aber es ist ein Bild, das mit Krankheit und Tod verbunden ist. Wer Lebendigkeit sucht, sollte – um noch einmal Schafroth zu paraphrasieren – auf Bruchstückhaftigkeit beharren, gerade auch jener einer Stadttopographie.
Buchstückhafte Stadttopographie
In Strafarbeit, Steiners erstem Roman, lässt er 1962 zum ersten Mal eine bruchstückhafte Stadttopographie ausdrücklich als jene Biels erkennen. Und wenn man Umberto Eco folgt, kann man auch erst hier tatsächlich von Stadttopographie sprechen. Eco zeigt, wie Alessandro Manzoni seinen Roman I promessi sposi damit beginnt, dass er den Comersee aus olympischer Perspektive zunächst beschreibt, „als filmte er sie sie einem niedersinkenden Hubschrauber“40, und dann im Zoom auf den Ausfluss der Adda immer mehr Einzelheiten sichtbar macht, und er nennt den Wechsel der Ansicht „vom Weiten zum Engen, vom See zum Fluss“41 als einen solchen „vom geographischen Oben zum topographische Unten“42. Eine Stunde vor Schlaf lässt Grub mit der Panoramasicht auf die Stadt und ihre Umgebung in einer „geographische[n] Dimension“43 als Biel erkennen, Strafarbeit hingegen folgt in der Darstellung Biels der an Einzelheiten haftenden Oligooptik des Protagonisten und Erzählers Rudolf Benninger und bietet den Lesenden so eine „topograpische Annäherung“44. Diese bleibt lückenhaft, unübersichtlich, ja gar unzuverlässig, denn das kennzeichnet auch den ganzen Bericht Benningers. Dass diesem nicht voll vertraut werden kann, kündigt indirekt schon der Titel des Romans an. Denn was darin erzählt wird, ist das Ergebnis einer Strafarbeit, eines Schreibens also, das dem Erzähler als Strafe auferlegt wird. Nicht einfach nur das Leben Benningers ist so das zentrale Thema des Romans, sondern die Art, wie er schreibend darüber Auskunft gibt. Dass schon der Titel Strafarbeit das ankündigt, wurde in den bisherigen Besprechungen des Romans kaum gewürdigt.
Benninger hat, abgesehen von seinen Ausbruchsversuchen, von Kindsbeinen an nur im „Schwererziehbarenheim“ und der „Strafanstalt“ (W1, 36) gelebt. Als er nach einem längeren Ausbruch einmal mehr in die Haftanstalt Brandmoos zurückgekehrt ist, muss er auf „Befehl der Direktion“ (W1, 61) und „[i]m Auftrag der Staatsanwalt“ (W1, 164) einen Bericht über seine Flucht schreiben. Aufgrund „schwere[r], vermutlich epileptische[r] Anfälle (W1, 164) wird er vorübergehend in die „Beobachtungsstation“ (W1, 99) einer Universitätsklinik verlegt, dann aber „als voll zurechnungsfähig zur Verwahrung auf unbestimmte Zeit nach Brandmoos zurückgeschafft“ (W1, 164) und schreibt dort eine zweite Version seines Fluchtberichts. Schon der ersten Version war in den Augen der Strafbehörden „jegliche Beweiskraft abzusprechen“ (W1, 164), nun sehen sie auch in der zweiten Version und den „harmlose[n], tagebuchartige[n] Aufzeichnungen“ (W1, 164), die Benninger in der Klinik verfasst hat, „erwiesenermaßen […] nicht wahrheitsgetreue Schilderungen in dem von uns erhofften Sinne des Bekenntnisses.“ (W1, 164)
Das erfahren wir als Lesende erst im Epilog des Romans, doch schon bei dessen Lektüre drängt sich uns immer wieder der Eindruck auf, Benninger vermische fortlaufend Faktisches mit Fiktivem und vermenge verschiedene Zeiten und Ereignisse. Inwieweit er solche Kontaminationen absichtlich herbeiführt oder sie ihm unbewusst unterlaufen, lässt sich nicht eindeutig entscheiden. Fest steht zum Schluss nur, dass er „den Bericht nicht freiwillig niederlegte“ (W1, 163), oder wie er zuvor schon seinem Häftlingsbetreuer sagt: „[D]ie da oben zwingen mich dazu“ (W,110). Nun findet er aber ironischerweise gerade unter diesem Zwang von außen jene Möglichkeit zum Widerstand, die er in seinen Ausbruch- und Fluchtversuchen immer wieder vergeblich gesucht hat:
Erst nicht mehr schreiben können, verstummen hieße: unwiderruflich am Ende sein. […] Im Aufstand gegen das als unanfechtbar Ausgegebene bewahrt er sich seine Identität, oder genauer: schafft er sie sich erst. Daraus ergibt sich folgerichtig, dass Benninger es Ärzten und Behörden – und auch dem Leser – unmöglich macht, seiner wirklichen Geschichte auf die Spur zu kommen.45
Aber auch Benninger selbst ist dazu kaum in der Lage: „Sie verlangten nach dem Plan, den sie als Schlüssel ansahen zu einem mir unbekannten Ganzen“ (W1, 55), schreibt er über die Strafbehörden, und später hält er fest: „Meine Pläne haben den Nachteil der Ungenauigkeit. Nur bestimmte Punkte sind festgelegt, der Rest ist Improvisation“, fügt aber gleich hinzu: „Das behauptet B.“ (W1, 77), sein Häftlingsbetreuer in Brandmoos. Wie auf seiner Flucht kann Benninger auch in seinem Bericht keinem Plan folgen, hat keinen Schlüssel zu einem ihm „unbekannten Ganzen“, sondern „nur bestimmte Punkte“, an denen er sich orientieren kann und muss improvisieren: „Die Wirklichkeit zerbröckelte […] und schwand im ungeheuren Verschleiß des Beweisverfahrens. Sie sprachen von Rekonstruktion“ (W1, 107), hält er fest.
Das gilt auch für die Stadttopographie, die seinem Bericht zu entnehmen ist. Das Bild Biels ergibt sich für die Lesenden erst „über das Abrufen von als bekannt vorausgesetzten und voraussehbaren Teilelementen“46, der Roman verfolgt so eine literarische Stadtkonstitution, die in der Forschung als „prototypisch“47 bezeichnet wird. Durch den Ortsnamen mit dem realen Biel identifiziert wird die zuvor nur allmählich zu erkennende Stadt erst nach fast fünfzig Seiten, als „der Besitzer eines Verlagshauses aus Zürich und Ascona [Benninger] auf Quai 1 des Bieler Bahnhofs herumlungern“ (W1, 48) sieht. Nach nochmals dreißig Seiten fährt Benninger dann mit dem Fernsehmann Boulanger, den sein Betreuer B. „vor Jahren in Biel kennengelernt“ (W1, 78) hat, zu Dreharbeiten für eine „Entführungsszene in einem Werbefilm für die Haute Couture“ (W1, 79) in eine Vorstadt hinaus, die im Biel der Jahre um 1960 lokalisiert werden kann.
Vor und nach den beiden Nennungen ihres Namens lässt sich die Stadt, in der Benninger sich vor möglichen Häschern zu verstecken sucht, nur durch eine „Reihe von Markern“48 als Biel identifizieren. So nennt Benninger auf dem Gang in die Innenstadt eine Reihe von Cafés, die es nur im Bahnhofsbereich des realen Biel gibt: „Als Seeland, Brézil, Farbhof, Quick entpuppten sich im Neon die Lokale, alle zu hell erleuchtet und überfüllt.“ (W1, 24) Er benennt die Cafés anhand ihrer Neonanschriften, denn er ist kein Einheimischer, er kennt die Gegebenheiten nur als ein Unterschlupf suchender Flüchtling. Das betont er auch dadurch, dass er „in den Terrassen der offenen Cafés […] die Küstensicherheit der Sesshaften“ (W1, 24) vermutet und sie so in deutlichem Kontrast zu seiner unsicheren Unstetigkeit sieht. Wenn er die Cafés einzeln benennt, ist das weniger im Sinne Roland Barthes‘ als ein Realitätseffekt zu verstehen, der Wirklichkeitsnähe allgemein vortäuscht, denn im Sinn von Barbara Piatti, als ein „Realisierungseffekt“49, der es erlaubt, die benannten Dinge auf einer Karte oder einem Stadtplan zu lokalisieren. Benninger ist auf den so verstandenen Realisierungseffekt dieser Benennungen angewiesen, um bei den Behörden den Eindruck zu erwecken, sein Bericht zeichne sich durch Faktentreue aus, selbst wenn diese durch das Ablesen der Neonanschriften der Cafés vermittelt ist. Noch deutlicher zeigt Steiner eine solche mediatisierte Wiedergabe der Wirklichkeit am Bespiel der „Cité Marie“ (W1, 69). Denn dieses real existierende historische Armenviertel im Bieler Stadtzentrum50 erscheint im Roman nur als „zufällig mitgenommene[r] Hintergrund“ (W1, 69) im Fernsehfilm jenes Boulanger, den Benninger schon auf der Drehortsuche in eine Vorstadt Biel begleitet hat. Den Eindruck der Unwirklichkeit des mediatisierten Bildes verstärkt der Text dadurch, dass der Film unmittelbar zuvor in einer surreal wirkenden Szene „anthrazitfarbene Alleebäume, pflaumenblauen Nebel, Menschen, die auf Hunden ritten“ (W1, 69) zeigt. 51
Die Topographie der Stadt Biel im Roman entspricht insofern der Wirklichkeit Benningers, als darin – wie in seinem Leben – „nur bestimmte Punkte […] festgelegt“ (W1, 77) sind und sie keinen „Schlüssel“ bietet zu einem ihm „unbekannten Ganzen“ (W1, 55). Sie entfernt sich zugleich in dem Maße von seiner Wirklichkeit, wie diese Punkte ihm nur in Anschriften oder Filmausschnitten mediatisiert wiedergegeben zu sein scheinen. In dieser Mischung von erlebter Realität und Imagination erscheint sie auch das einzige Mal, wo Benninger sie in der Erinnerung als ein Ganzes zu sehen vermeint:
Ich denke an jene Weihnachtstage, und die Stadt hat sich in das Netz ihres eigenen Traumes zurückgezogen. Als Luftspiegelung sehe ich sie im Grau, manchmal von einem Wind aus großer Höhe aufgerührt, zu neuen Mustern umgeschichtet. (W1, 85)
Im erinnernden Rückblick erscheint die Stadt weder wie in Eine Stunde vor Schlaf als Anschauungsraum noch wie in Strafarbeit als Aktionsraum, sie wird in erster Linie zum atmosphärisch „gestimmten Raum“52. Dessen „Vernehmen ist kein Wahrnehmen, sein Gewahren kein Erkennen, es ist vielmehr ein Ergriffen- und Betroffensein.“53 So wird die Stadt hier weder von unten als Sammlung topographischer Teilelemente gesehen noch von oben als ein geographisches Ganzes, sondern als „Luftspiegelung“, die im Wind von oben immer wieder „zu neuen Mustern umgeschichtet“ zu werden scheint.
Paradoxe Bezugnahme
In allen drei bisher beobachteten Erscheinungsweisen der Stadt dient der Bezug auf das reale Biel Steiner nicht dazu, den Schein einer Wiedergabe des Tatsächlichen zu wecken, sondern, im Gegenteil, ihn als solchen durchschaubar zu machen. Dass ein Text sich mit Namensnennung auf wirkliche Gegebenheiten bezieht, um deutlich zu machen, dass sich irrt, wer sich an diese Bezugnahme hält, ist ein paradoxes Verfahren. Doch wer Steiner liest, muss mit Paradoxien umgehen lernen. Schon der Titel Strafarbeit hat sich ja insofern als paradox erwiesen, als die doppelte Mühsal, die die Worte „Strafe“ und „Arbeit“ ankündigen, in der Ausführung der Strafarbeit für Benninger umgekehrt zur Möglichkeit wird, den Beschwernissen seines Lebens zu widerstehen und im Schreiben geradezu eine gewisse Befreiung zu finden.
Ein Paradox enthält auch der Titel Ein Messer für den ehrlichen Finder von Steiners zweitem Roman. Wenn der Finder ehrlich ist, kann das Messer nicht für ihn sein, sondern nur für den Besitzer, dem er es zugänglich machen sollte, und wenn es tatsächlich für ihn ist, kann er kein ehrlicher Finder sein, weil er es ja als Besitz einer anderen Person gefunden hat. Noch radikaler als Strafarbeit offenbart dieser zweite Roman Steiners auch die Paradoxie der Bezugnahme auf Biel, die darin liegt, dass es mit ihr gerade nicht darum geht, die Topographie der realen Stadt dargestellt zu finden.
Biel spielt in Ein Messer für den ehrlichen Finder insofern eine zentrale Rolle, als der Protagonist des Romans, José Claude Ledermann, Schose oder auch Schnorrer genannt, in dieser Stadt aufwächst, bis er sechzehn ist. Mit sechzehn ersticht Schose seinen Klassenkameraden Tillmann vor dem Gymnasium, das beide besuchen, weil dieser das Fahrrad weiterverkaufte, das Schose ihm ausgeliehen hatte. Schose wird zur Haft in der Jugendstrafanstalt Brandmoos verurteilt – sie hat schon in Strafarbeit eine zentrale Rolle gespielt – , nach zwei Jahren auf Bewährung entlassen, ist zunächst Laufbursche auf einem Lastkahn und wird dann – auf Veranlassung seines Vormundes Hügli – Angestellter des Berner Arbeitsamtes und schließlich Magazinverwalter und Hauswart des Kunstmuseums Bern. Wir verfolgen seine Geschichte von 1943 bis 1950 und damit auch die Entwicklung der Stadt Biel vor und nach dem Ende des 2. Weltkriegs.
Wiederum erfahren die Lesenden den Namen der Stadt erst nach einigem Lesen, ein erstes Mal nach gut dreißig Seiten (W1, 202), ein zweites Mal mehr als sechzig Seiten später (W1, 268-269). Erneut aber stellt der Text vor und nach der Nennung des Ortsnamens durch deutliche Marker Bezüge zu Biel her. Der Roman konstituiert sein Text-Biel vor allem aus drei „prototypischen Teilreferenzen“54, die im ganzen Roman wiederholt auftauchen: die Kanalgasse – Hauptverkehrsader der Stadt für den Durchgangsverkehr zwischen Solothurn und Neuchâtel – die Marktgasse, die parallel zu ihr durch eine Häuserreihe vom Verkehr abgeschirmt ist, und das Gymnasium, das Schose bis zu seiner Verhaftung besucht, ein Wahrzeichen der Stadt, „auf halber Höhe am Südhang, […] ein mächtiges, ockergelb gestrichenes Gebäude“ (W1, 210). Das Biel dieses Romans beschränkt sich topographisch weitgehend auf diese drei Schauplätze: mit besonderer Häufigkeit auf die beiden Gassen und zweimal auf das Gymnasium. Denn der Roman folgt ja dem Leben seines Protagonisten Schose, und dieser wohnt, solange er in Biel lebt, in einem Haus zwischen den beiden Gassen und besucht das Gymnasium. Im Unterschied zu Strafarbeit ist es aber nicht der Protagonist, der sein Leben erzählt, sondern eine Erzählinstanz, die sich zwar an seine Wahrnehmungen hält, aber in einer gewissen „Verhaltenheit“55, die uns im Unterschied zum traditionellen personalen oder auch auktorialen Erzählverhalten keinen direkten Zugang zu den inneren Regungen Schoses ermöglicht, sondern in der „Öffnung auf über- oder unpersönliche Denkmuster“56 Abstand von ihm nimmt und dabei zugleich in „einem unauflöslichen Spannungsverhältnis“57 zur Sprache verbleibt, die diese Denkmuster prägt. So gibt der Roman
nicht den Blick frei auf vorgefundene, klar umrissene Situationen und Figuren, sondern stellt sie Satz für Satz her, darauf hinweisend, dass das Ziel seines Schreibens nicht im Abbilden liegt, sondern in der Fruchtbarmachung der Spannung, die sich zwischen dem Darzustellenden und der Art der Darstellung ergibt. 58
Das gilt insbesondere auch für die Dar- oder besser: Herstellung der Stadttopographie Biels. Auf fast apodiktische Weise kündigt gleich der erste Satz an, dass es dem Autor nicht darum geht, ein möglichst wirklichkeitsnahes Bild seiner Heimatstadt zu vermitteln: „Hier sind die Gärten.“ (W1, 169) „Hier“ ist nicht Biel, nicht die Wirklichkeit, „hier“ ist der Text selbst. Er präsentiert zunächst seine Gärten und spezifiziert dann: „Es sind die Gärten des Jahres 1943 in der Schweiz.“ (W1, 169) Als Gärten des Textes können sie dann Blumen, Gemüse und Früchte tragen. So wie er sie zu Beginn hinstellt, kann der Text die Gärten später auch wieder zurücknehmen bzw. in Frage stellen. Das zeigt sich nach einem Unfall Schoses mit dem Fahrrad, der seinen Plan, Rennfahrer zu werden, zunichte macht. Der Text greift den zweiten Satz des Romananfangs noch einmal auf: „Es sind die Gärten des Jahres 1943“, um dann fortzufahren:
Die Gärten der Marktgasse: hat es da je Gärten gegeben? Es ist erlaubt zu fragen; man möchte die Wahrheit wissen. Man weiß es nicht besser. Wenn man die Wahrheit erfahren will, fragt man. Wer sich Gärten vorstellt, redet von Gärten. (W1, 169)
Was von den Gärten und von der Marktgasse gilt, ist auch maßgebend für die ganze Stadt: Man „redet“ von ihr, weil man sie sich vorstellen kann. Lesende, die die Wahrheit des Textes erfahren wollen, sollten sich also als „Modell-Leser“59 im Sinne Umberto Ecos an die Vorstellungen halten, die die Lektüre bei ihnen hervorruft, und den Roman nicht im „Eifer des empirischen Lesers“60 darauf hin überprüfen, ob seine topographischen oder historischen Angaben mit der faktischen Wirklichkeit übereinstimmen. „Modell-Leser“ im Sinne Ecos akzeptieren im Prinzip „alles, was im Text nicht ausdrücklich als verschieden von der wirklichen Welt erwähnt oder beschrieben wird, […] als übereinstimmend mit den Gesetzen und Bedingungen der wirklichen Welt“61. Diese Übereinstimmung würde, so Eco, zum Beispiel dann in Frage gestellt, wenn die Detektiv-Figur Archie Goodwin in einem Kriminalroman von Rex Stout „auf der Fifth Avenue ein Taxi anhielte und sagte, er wolle zum Alexanderplatz, denn der Alexanderplatz befindet sich, wie wir von Döblin wissen, in Berlin.“62 Möglich wäre ein solcher Wunsch in einem New Yorker Taxi, wenn der Taxigast halluzinierend jede Wirklichkeitsorientierung verloren hätte oder die Figur eines Textes wäre, der der phantastischen Literatur zuzurechnen ist. Eine dritte Möglichkeit bietet Steiner in Ein Messer für den ehrlichen Finder damit, dass er Lesende mit Bieler Ortskenntnis vor dem „Eifer des empirischen Lesers“ warnt, indem er auf der Kanalgasse seines Romans einen Vorgang zeigt, der sich auf der Kanalgasse der Wirklichkeit nicht abspielen könnte. Wolf, der Schose als Radrennfahrer trainiert hat, sieht nach dem Unfall seines Schützlings keine Möglichkeit einer Sportkarriere mehr für diesen, verschweigt ihm dies bei einem Krankenbesuch, lässt aber beim Verlassen des Hauses, in dem er den Verunfallten besucht hat, das Wachstuchheft mit dessen Trainingszeiten wie unabsichtlich in einen Kanal fallen:
Er benützt den Haupteingang an der Kanalgasse. Er überquert die Gasse; da ist der Kanal. Wolf spuckt ins Wasser; das macht hier jeder so. Er greift unter den Pullover und holt das Wachstuchheft hervor. Er öffnet es nicht, er zerreißt es nicht. Das Heft fällt ins Wasser.“ (W1, 191-192)
Für Lesende ohne Ortkenntnis stimmt hier alles: Wo es eine Kanalgasse gibt, muss es einen Kanal geben. Lesende aber, die Biel kennen, wissen, dass die reale Kanalgasse zwar so heißt, weil sie in vergangenen Jahrhunderten an einem Kanal lag, dass sie den Namen bis heute aber nur beibehalten hat, weil sie dem Kanal folgt, indem sie ihn über ihre ganze Länge überdeckt. Da kann nichts von ungefähr hineinfallen. Und das war auch 1943 schon so. Wie schon in Eine Stunde vor Schlaf und in Strafarbeit macht Steiner also auch in Ein Messer für den ehrlichen Finder seine Heimatstadt nicht zum „unvermeidlich wiederkehrenden Ort seines Erzählens“, damit die Lesenden das tatsächliche Biel darin suchen, sondern umgekehrt, damit ihnen klar wird, dass es viel eher darum geht, diesen Ort – wie er als Pavese-Leser das Flüsschen Belbo – „nur im Spiegelbild der Geschichte“ als das Biel [zu] erkennen, das sie „teilhaben lässt an dem durch [seine] Erzählung überlieferten, erfundenen und beglaubigten Schicksal anderer Menschen.“ (W4, 343) Und darauf stößt er Lesende mit Bieler Ortskennnissen, die versucht sein könnten, sich bei der Lektüre an die Topographie des Bieler Stadtplans zu halten, indem er sie mit dem offenen Kanal an der Kanalgasse seines Textes überrascht.
„Sanierung und so weiter“
Am „überlieferten, erfundenen und beglaubigten Schicksal anderer Menschen“ lässt Steiner uns unter anderem so teilnehmen, dass er aufzeigt, welch radikale Veränderung Biel am Ende des 2. Weltkriegs bis 1950 erlebt. Aufgrund der rigorosen Einschränkung des Autoverkehrs können Kinder und Jugendliche zwischen 1939 und 1945 selbst die wichtigsten Straßen des Stadtzentrums für ihre Spiele besetzen: „Die Marktgasse eignet sich als Spielplatz genausogut wie die Kanalgasse. Überall sind kleine Kinder dabei, mit ihren viel zu lauten Stimmen.“ (W1, 170) In der Annahme, nach dem Kriegsende werde die Schweiz wie nach dem 1. Weltkrieg eine Wirtschafts- und Sozialkrise erleben, bereitet die Stadt zur Beschäftigung der erwarteten Arbeitslosen umfangreiche Baumaßnahmen vor (vgl. W1, 235/6). Auch die Marktgasse soll verbreitert werden: „Fort mit den Teppichklopfstangen, fort mit den zerfressenen Jurasteinen an den Wegrändern. […] Die Gärten, das ist lange her.“ (W1, 354) Schose, der in Bern zum Magazinverwalter und Hauswart des Kunstmuseums Bern geworden ist, findet dort hingegen, im Park vor seiner Wohnung, einen neuen Garten: „Das ist mein Garten. Es ist ein Garten des Jahres 1950.“ (W1, 384) Vom stattlichen und ordentlichen Bern aus gesehen, bleibt Biel „ein großes Dorf. Jeder baut seine Häuser, wie es ihm passt. […] Eine Goldgräberstadt, sagten die Herren. […] Leute, die nur dem Geld nachjagen, Spekulanten, die in jeder Krise zugrunde gehen, lauter Industrielle. Die Industrie ist unseriös“ (W1, 268), sagen die Herren von Bern, in deren Dienst Schose sich begeben hat. In Bern spüre man, „dass die Stadt vor Jahrhunderten als Festung gegründet worden ist. An ihren Mauern prallt der fremde Einfluss ab.“ (W1, 268) Biel erscheint demgegenüber als Stadt in ständiger Veränderung. Der bleibende „Garten des Jahres 1950“ in Bern steht im Gegensatz zu den „Gärten des Jahres 1943“ in Biel, die ebenso wie die Spielmöglichkeiten der Kinder auf den Straßen durch deren Verbreiterung zugunsten des wachsenden Autoverkehrs verschwunden sind. Der Roman stellt sein Biel, was diese Entwicklung angeht, als pars pro toto für die Schweiz dar, denn es geht gemäß dem Romananfang ja ausdrücklich um „die Gärten des Jahres 1943 in der Schweiz“ (W1, 169). Sein Bern hingegen erscheint in seiner festungsartigen Abschirmung nach außen und mit dem „Garten des Jahres 1950“ als Ausnahme.
Die sich fortlaufend verändernde Stadttopographie Biels steht also paradigmatisch für eine Entwicklung der Schweiz, deren Städte unter dem Einfluss des Wirtschaftsbooms und der Übernahme des „American Way of Life“ mit einer rasanten Zunahme des Autoverkehrs ab 1945 einen radikalen topographischen Wandel erfahren, auch ohne die großen Kriegszerstörungen ihrer Nachbarländer in den 1950er bis 1970er Jahren. Das lassen die Texte, die Steiner von 1962 bis 1980 veröffentlicht, immer wieder in konkreten Beispielen durchblicken. So begegnet Benninger im Biel der späten Fünfzigerjahre in Strafarbeit bei seiner Ankunft im Stadtzentrum auch gleich imposanten Bauarbeiten:
Über dem Kanal war ein Hochhaus im Bau. Krachend fiel der Dampfhammer in regelmäßigen Intervallen auf die mächtigen Eisenpfosten. Krane setzten menniggestrichene Stahlträger am Straßenrand ab. Ein verbundenes Fenster der Baubaracke starrte über den fressenden Bagger in der Tiefe hinweg. (W1, 34)
Solche Bautätigkeit prägt auch die Vorstadt, in die Benninger mit dem Filmer Boulanger hinausfährt: „In die Schrebergärten stoßen Hochhäuser. Der graue Novembertag ist ein von Schlaglöchern zerrissenes Gelände. Sieches Wachstum enthüllt überall Blößen: Erde fehlt. Zäune, schlecht verheilte Nähte, spannen die überdehnte Haut.“ (W1, 78) Die an den Expressionismus erinnernde Anthropomorphisierung der sich wandelnden Stadttopographie führt Weber auf die „expressive, pulsierende Kraft“63 zurück, die Benninger, der in der Haftanstalt nicht von ungefähr Vulkan heiße, auch als Schreiber präge. Es sei seine „eruptiv-vitale Sprache, die alles in Bewegung versetzt, was sie erfasst.“64 Doch auch im deutlich sachlicheren Stil des zweiten Romans und den weiteren Texten, die Steiner bis in die 1980er Jahre schreibt, wird Biel wiederholt als Stadt in ständigem Umbau beschrieben. Der Text Zuletzt muss man springen in Auf dem Berge Sinai sitzt der Schneider Kikeriki von 1969, einem „Geschichtenbuch“ (W3, 105), wie der Untertitel der Erzählsammlung ankündigt, lässt einen Lehrer sagen: „Es wird ein Hochhaus gebaut, das weiß jeder. Auf den neuen Plänen gibt es eure Tankstelle nicht mehr. Sie wird an die Straße zurückgenommen, wenn einmal die Straße gebaut ist, das weiß man doch.“ (W3, 34) In Zu warm für Oktober aus derselben Erzählsammlung ist eine Straße an ein Haus herangerückt, das vorher durch einen Garten von ihr getrennt war: „Ein kleiner Vorgarten ist nach der Verbreiterung stehengeblieben; eine Eibe, ein paar Hagbuchen; Thuja.“ (W3, 55) In Reise durch eine besetzte Gegend bereut ein Bewohner an einer Bieler Vorortstraße das Verschwinden der Gärten: „Er beklagt sich, es gebe in der Dennerstraße keine Gärten; aber mit den Kindern kommt er gut aus.“ (W3, 89) Und wie ein Leitmotiv dieser Thematik zieht sich die Erwähnung der Cité Marie durch das ganze „Geschichtenbuch“. In dessen drittem Text, Was der Mensch vernünftig will, das kann er, erwägt ein Bewohner dieser Siedlung, in der die Wohnungen „zimmerweise vermietet“ werden, die Möglichkeit eines Brandes: „Wenn die Cité Marie einmal brennt, bringe ich die Kommode in Sicherheit.“ (W3, 29) Im vierten Text, Zuletzt muss man springen, kündigt der oben schon zitierte Lehrer im Zusammenhang mit der Cité Marie an: „Nach den Plänen im Stadtbauamt ist auf eurem Platz ein Hochhaus vorgesehen; der Unteroffiziersverein hat sich anerboten, hier endlich Ordnung zu schaffen.“ (W3, 37) Im ebenfalls schon zitierten Text Zu warm für Oktober, dem siebten des Bandes, hat die Cité Marie schon gebrannt. Ihr Hauswart zieht eine Brandstiftung in Zweifel und sagt: „Immerhin darf darauf hingewiesen werden, dass die Cité-Marie abbruchreif war.“ (W3, 58) Im zwölften und drittletzten Text, Hauptsache, ein harmloser Fall, ist wieder vom Hauswart die Rede: „Er hat den Brand der Cité Marie mitgemacht und den Ärger mit dem Neubau.“ (W3, 82) Seine „Cité Marie heißt jetzt Block 42.“ (W3, 83)
In der Erzählung Schnee bis in die Niederungen greift Steiner 1973 mit mehreren Figuren aus Ein Messer für den ehrlichen Finder auch das Thema der sich wandelnden Stadttopographie wieder auf. Ein Hof, in dem die Kinder im Lauf der 1960er Jahre noch spielen konnten, ist am Ende des Jahrzehnts „zu einem Parkplatz umgebaut worden.“ (W3, 123) Nun binden manche Mieter „ihre Kinder an einem Tischbein an, wenn sie weggehen müssen“ (W3, 123), sagt eine Mutter. Sie schließt ihren Bericht mit dem Fazit: „In dieser Welt kann man nicht mehr leben, es ist nicht mehr eine Welt für Menschen.“ (W3, 125) Reubell, der Freund Schoses, der in Ein Messer für den ehrlichen Finder in die USA ausgewandert ist, wohnt nun nicht mehr dort, sondern „in einem Wohnblock des Jahres 1960“ (W3, 139) am Rand der Bieler Altstadt: „Die Altstadt ist nie von Bulldozern planiert worden; hier sind auch keine Bomben gefallen“ (W3, 139), hält der
Text fest. Aber wenn Reubell am Fenster steht und die Aussicht betrachtet, sieht er „eine Baugrube, ein Eineinhalbmillionenloch.“ (W3, 139)
Das Netz zerreißen, der dritte Roman Steiners widmet sich 1982 noch einmal der ganzen Periode zwischen 1951 und 1961, und wieder spielen das Brandmoos und – so wie mit Reubell im zweiten Roman – die USA und natürlich vor allem Biel als Schauplätze eine wichtige Rolle. Diesmal wird die Stadt nie namentlich genannt, die schon erwähnte Panorama-Ansicht auf dem Gang zum Krankenhaus (W2, 249) sowie einzelne – für Lesende mit Ortskenntnis eindeutige – toponymische Marker wie z. B. die Wildermethmatte (W2, 213) sowie die Nidaugasse und einmal mehr die Kanalgasse (W2, 239) lassen aber eindeutig erkennen, dass auch dieser Roman auf Biel Bezug nimmt. Nun verweist nur noch eine Stelle direkt auf die stürmische Hoch- und Tiefbauaktivität, die die Topographie der Stadt in den 1950er Jahren umgekrempelt hat: „Ganze Straßenzüge werden abgebrochen, die Straßen werden verbreitert, Neubauten werden aus dem Boden gestampft, mehr Komfort, bessere Ausnützung, kleinere Küchen, zu stark beheizte Kellerchen; Sanierung und so weiter“ (W2,118), sagt Robert Knecht, der Besitzer des Restaurants Schönegg, dessen gebrochene Familiengeschichte der Roman in vierzig Einzelepisoden über zehn Jahr hinweg erzählt. Seine Aussage erweist sich als „Mise en abyme“ der Romanhandlung, als Bild im Bild, in dem sich im Einzelnen spiegelt, worum es im Ganzen geht. Denn letztlich ist der Hauptakteur des Romans die Schönegg, die schließlich den Bauunternehmern und -spekulanten zum Opfer fällt. In ihr verknüpfen sich die verschiedenen Netze, die der Roman ausspannt. Um 1961 überlässt Knecht das Restaurant dem Baulöwen Satori, um seinen Freund Sugus vor der psychiatrischen Verwahrung zu retten. Doch bevor er mit Sugus verschwindet, weil er sich mit diesem „irgendwo in der Welt mehr zu Hause fühlte als allein daheim“ (W2, 269), lässt er das Restaurant niederbrennen. Sein Stammgast Kohler deutet Knechts Verschwinden gegenüber der Stammrunde, es sind „Arbeiter vom Schlachthof, Pensionierte, Leute von der Güterexpedition“ (W2, 118), als Befreiung:
Es ist ihm etwas zugestoßen […]. Das kennt ihr ja auch. Man behängt uns mit Gewichten. Man höhlt uns aus. […] Wer sich wehrt, zappelt im Netz. Und dann, eines Tages, hast du auf einmal die Kraft, das Netz zu zerreißen. Das ist es vielleicht, was Knecht zugestoßen ist. (W2, 275/6)
So stellt Kocher das Zerreißen des Netzes, das der Romantitel anspricht, nicht als einen heroischen Befreiungsakt dar, sondern als etwas, das Knecht „zugestoßen“ ist, und lässt seine Erklärung mit dem relativierenden „vielleicht“ auch als nur eine der möglichen Deutungen des Geschehens erscheinen. Er gilt in der Freundesrunde ohnehin als „Geschichtenhausierer“ (W2, 270). Seine Freunde lachen: „Kocher, der Anarchist! War das so gemeint gewesen, Anarchie? alles aus der Kraft einer inneren Wahrheit? Egal, ob so oder ähnlich: ihnen lieferte es das Stichwort“ (W2, 276). Im letzten Satz des Romans beschränkt sich die Anarchie Kochers und seiner Stammtischfreunde dann darauf, dass sie „nicht auf Grün“ (W2, 277) warten, um die Straße zu überqueren. Was 1961 aus den zehn Jahren ihrer Geschichte noch bleibt, sagt schon das Bild mit den Straßenverbreiterungen und Neubauten um 1952: „Sanierung und so weiter“ (W2, 118)
Im Erzählband Olduvai von 1985 heißt Sanierung in Biel dann nicht mehr Aufbruch im Bauboom, sondern, wie 1975 tatsächlich geschehen 65 , Stilllegung der Autoproduktion in den Bieler Montagehallen der amerikanischen Firma GM. Im Text Das Werk. Entwurf zu einem Drehbuch erinnert sich ein Filmer daran, dass die General Motors Biel Anfang der 1930er Jahre „von arbeitslosen Uhrmachern erbaut worden“ ist, und fährt fort: „Arbeitslose der General Motors werden eine Fabrik für elektronische Apparate bauen.“ (W3, 194). Mit Olduvai nimmt Steiner Mitte der 1980er Jahre Abschied von den Bildern, die Biel als Industriestadt in ständigem Umbau zeigen.
Ein Denkmal auf alle Denkmäler
Der Roman Weissenbach und die anderen von 1994 zeigt dann mit Otterwil, der einzigen, im Sinne Barbara Piattis 66 „fingierten“ Stadt in Steiners Werk, eine postindustrielle Kleinstadt Anfang der 1990er Jahre. Weissenbach, ein Schriftsteller, immer in Otterwil sesshaft geblieben, ist mit den „anderen“, den „Baronen“ der Stadt, aufgrund ihrer gemeinsamen Schulzeit seit Jahrzehnten verbunden. Nun erlebt er, wie diese Notabeln 1991 aufgrund der großen ökonomischen und politischen Umwälzungen der beginnenden Globalisierung ihre Macht, ihr Ansehen und ihre Ehre verlieren. Sie haben Mühe damit, dass Weissenbach immer wieder über ihre Stadt schreibt – wie Steiner über Biel – und weisen ihn darauf hin,
dass Otterwil für einen Schriftsteller von Weissenbachs Format kein Thema sein könne, da es ihm doch allein um Literatur zu tun sei, nicht wahr? Warum also nicht einfach draufloserzählen, wie es einfach ist, das Leben, frisch von der Leber weg, Klartext, so dass es jeder versteht?“ (W2, 354)
Mit dem Unverständnis der Barone für Weissenbachs Schreibens – sie „selbst haben keine Zeit zum Lesen, leider“ (W2, 354) – spricht Steiner indirekt die Frage an, warum auch er seine Texte immer wieder auf seine Heimatstadt bezieht. Die Aussage der Barone zeigt, worin die Alternative eines Schreibens bestünde, wie sie es sich wünschten: einfach „draufloserzählen“, im „Klartext“, aber unverbindlich. Der Bezug auf die reale Stadt hingegen bringt jene Verbindlichkeit mit sich, die Weissenbach – wie Steiner mit Paveses Belbol67 – geltend machen könnte: Nur in der Bezugnahme auf seine Stadt erhält sein Erzählen die Verbindlichkeit, die darin liegt, dass er nicht einfach draufloserzählt, sondern das Verhältnis seiner Geschichten zur Wirklichkeit der Stadt zum Thema macht, indem er auf diese Bezug nimmt. So muss er zwar wie Steiner mit Biel die faktische Wahrheit der Stadt berücksichtigen, aber nicht auf diese zielt er letztlich, sondern – um erneut Peter Bichsel zu paraphrasieren – auf die Möglichkeiten dieser Wahrheit. 68
Eine gewisse Ironie liegt darin, dass Steiner die Frage des fortgesetzten Bezugs seiner Texte auf Biel auf dem Umweg über sein fiktionales Double Weissenbach gerade in dem Roman anspricht, in dem er Biel durch die imaginäre Stadt Otterwil ersetzt. Eine mögliche Antwort ist der Stelle zu entnehmen, wo Weissenbach an „neue und alte Arme, Außenseiter, Randfiguren, bedauernswerte Erschöpfte“ (W2, 352) denkt, sich sagt, dass er „sich zum Anwalt“ (W2, 352) für sie habe machen wollen, und sich fragt:
Ist es nicht so, dass er sich bei den Unglücklichen die Lebenskraft holt, mit der linken Hand sozusagen, mit der rechten aber die Mittel, die er zum Leben braucht, bei ihnen, bei den Baronen? Von ihrem Wohlwollen ist er abhängig, von ihrer guten Miene zu seinem bösen Spiel. (W2,352)
Über die Barone zu schreiben ist also schwieriger als über die Außenseiter und Randfiguren: „Wer Barone zur Sprache bringt, muss damit rechnen, dass sie sich einmischen.“ (W2, 354) Damit könnte Steiner den Grund angeben, warum er zum ersten Mal eine fingierte Stadt zum Schauplatz der Handlung macht: Wie wäre es, wenn Bieler Notable sich in den Baronen dargestellt sähen und sich „einmischten“?69
Die imaginäre Stadt des Romans erinnert nur von fern an Biel. Steinerleser und -leserinnen können sich durch den „Schatten, den die Thujahecke warf, in der Geborgenheit eines dicht belaubten Kastanienbaumes“ der „Herbstnachmittage von vor siebenundvierzig Jahren“ (W2, 324) und „das Huschen, das Summen, das Rascheln der vierziger Jahre“ (W2, 356) an die Bieler „Gärten des Jahres 1943“ in Ein Messer für den ehrlichen Finder erinnert sehen. Mit Biel vertraute Lesende erinnert der Kanal, der durch Otterwil fließt an den Schüsskanal der Stadt am Jurasüdfuß: „Der Kanal ist eine Windschneise. Er teilt die Stadt und versorgt sie mit Frischluft“, hält der Text fest und fügt vielsagend hinzu: „das ist alles, was es zu sagen gibt“ (W2, 333), wie wenn er damit sagen möchte: Auf eine Parallele zu Biel soll damit nicht geschlossen werden, deshalb wird hier auch nicht mehr darüber ausgeführt. Immerhin erinnert Otterwil auch noch von Beginn des Romans an durch die „geologische Beschaffenheit des Bodens“ (W2, 283) mit seinen „auf Holzpfählen stehenden Gebäuden“ (W2, 284) an Biel. Denn wie in der auf ehemaligem Sumpfgebiet gebauten Heimatstadt des Autors, steigt in der imaginären Stadt seines Romans „Wasser in Hülle und Fülle […] aus unerschöpflichen, unterirdischen Adern“ (W2, 432) empor. Diese Besonderheit der Stadt kann mit ein Grund sein, warum sie Otterwil heißt. Ein anderer wäre, dass Otterwil auch eine Verdeutschung des französischen „autre ville“, die andere Stadt, sein könnte. Ausdrücklicher als auf Biel verweist der Roman nämlich auf eine andere Stadt im Kanton Bern. Er spricht vom „Jubeljahr der Republik“ (W2, 322), also von der Siebenhundertjahrfeier der Schweiz, und erwähnt dabei die „Achthundertjahrfeier der Stadt“ (W2, 322), und die fand 1991 nicht in Biel, sondern in Bern statt.
Doch ihr wichtigstes Wahrzeichen hat die imaginäre Stadt im Roman weder mit Biel noch mit Bern gemeinsam, sondern mit verschiedenen Städten im Mexiko. Dort wird der jeweilige zentrale Platz der Stadt umgangssprachlich als Zócalo, als Sockel, bezeichnet, weil er das einzige Überbleibsel der aztekischen Pyramide ist, die einst auf ihm stand und von den spanischen Eroberern abgerissen wurde.70 Auch in Otterwil heißt der zentrale Platz nicht mehr „Platz der Freiheit“, sondern „Sockelplatz“ oder „Söckelchen“. Auf die Parallele mit mexikanischen Städten verweist der Text indirekt mit dem Satz: „Das Söckelchen in Otterwil hätte nun als Attraktion mehr zu bieten als eine mexikanische Pyramide.“ (W2, 424). Doch das Otterwiler Söckelchen ist kein Überbleibsel einer ehemaligen Pyramide, sondern ein solches ehemaliger Denkmäler. Den Platz hat jede Regierung
nach dem Freiheitshelden, dem sie ihre Verfügungsgewalt zu verdanken scheint, benannt; aber weil die Regierungen sich selbst nicht überleben, sind die Helden einer nach dem anderen vom Sockel entfernt worden: auf Marmormonumente folgten bronzene Reiterfiguren, die ihrerseits heruntergeholt wurden, um einer sich selbst zerstörenden Maschine Platz zu machen, dann einem Hohen Ort, einer Himmelsleiter, einem Atlas. Es geht darum, die Freiheit darzustellen; um Kunst im Dienste der guten Sache geht es […], dauernd von Vandalen bedroht […]. Doch der Steinsockel überdauert auch sie, ihre Botschaften und ihre Sterblichkeit. (W2, 287)
Aus heutiger Perspektive liest sich diese Denkmalsatire von 1994 wie eine Voraussicht auf gegenwärtige Denkmalstreitigkeiten. Eher aber ist zu diesen satirischen Verweisen auf Marmormonumente, Reiterfiguren und Skulpturen (der Schweizer Plastiker Jean Tinguely mit „einer sich selbst zerstörenden Maschine“71 und Bernhard Luginbühl mit „einem Atlas“72) wohl von Robert Musil inspiriert worden, der in einem kurzen Essay in seinem Nachlass zu Lebzeiten festhielt:
Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler. […] Man muss ihnen täglich ausweichen oder kann ihren Sockel als Schutzinsel benutzen […]: aber man sieht sie nie an und besitzt gewöhnlich nicht die leiseste Ahnung davon, wen sie darstellen […]. Was aber trotzdem immer unverständlicher wird, je länger man nachdenkt, ist die Frage, weshalb dann, wenn die Dinge so liegen, gerade großen Männern Denkmale gesetzt werden? Es scheint eine ganz ausgesuchte Bosheit zu sein. Da man ihnen im Leben nicht mehr schaden kann, stürzt man sie gleichsam mit einem Gedenkstein um den Hals, ins Meer des Vergessens.73
So erscheint das Söckelchen in Otterwil wie ein Denkmal auf alle Denkmäler, die dazu beigetragen haben, dass diejenigen, die auf den Sockel gestellt wurden, uns „entmerken“, wie Musil schreibt: „sie entziehen sich unseren Sinnen“74.
Als wesentliche topographische Besonderheit Otterwils gibt das Söckelchen mit der Frage seiner Neugestaltung in diesem Roman mehr Anlass zu Streit und Diskussionen als in den Romanen und Erzählungen zuvor die wiederkehrenden Bautätigkeiten zur Verbreiterung der Straßen und Errichtung von Hochhäusern in Biel. Die Zeit des industriellen Wachstums der 1950er bis 1970er Jahre weicht ab den 1980er Jahren auch in Steiners Romanen und deren Stadttopographien der Zeit postindustrieller Reparaturarbeiten. Die Frauen, die sich in Weissenbach und die anderen „vorerst gegen die Abbruchsbewilligung, später gegen die Neugestaltung des Söckelchens“ wehren, „von Instanz zu Instanz bis zum obersten Gerichtshof“ (W2, 421) erinnern an das, was die Städtebautheorie ab Mitte der 1970er Jahre über das Bedürfnis der Stadtbewohnerinnen und -bewohner nach „städtebauliche[n] Identifikationsangebote[n]“ beobachtet:
Gegen die vor allem in den 1960er Jahren praktizierten Flächensanierungen, die Ersetzung gewachsener Stadtstrukturen durch städtebaulich und architektonisch monotone, standardisierte Großformen formiert sich Widerstand bei den Betroffenen, die zu einer Öffnung von Stadtplanung und Städtebau für Bürgerinitiativen und einer Erweiterung des disziplinären Top‐Down Verständnisses durch Bottom‐Up Strategien führen.75
Am Beispiel des Söckelchens in Weissenbach und die anderen zeigt Steiner die Ambivalenz, mit der die Anliegen solcher Botton-up-Initiativen umgesetzt werden: Für den motorisierten Verkehr wird „das Benützungsverbot der Parkanlage auf Druck der Motorpartei76“ (W2, 444) aufgehoben, dafür braucht das Söckelchen nicht dem von der Motorpartei geforderten unterirdischen Parkhaus zu weichen und das Stadtplanungsamt macht der Gegenseite ein Identifikationsangebot, indem es „einen Wettbewerb zur Belebung des Sockelplatzes“ (W2, 444) ausschreibt. Der Roman endet insofern versöhnlich, als am frühen Abend „im Licht der Straßenlampen die Bäume auf[flammen], lindengolden und kastaniendunkel“ (W2, 451) – so wie einst im Herbst „von vor siebenundvierzig Jahren“, an dessen „herben Geruch“ (W2, 324) Weissenbach sich zuvor erinnert hat.
„Eine Stadt ohne Mitte“
Die Erzählung Der Kollege, die Steiner 1996, zwei Jahre nach Weissenbach und die anderen, veröffentlichte, steht in völligem Gegensatz zum vorangehenden Roman. Nicht nur weil nun statt der Barone und ihrem Schriftstellerfreund Weissenbach der arbeits- und erwerbslose Bernhard Greif im Zentrum steht, sondern auch weil die Handlung statt im fingierten Otterwil wiederum in Biel situiert ist und der Text diesen Bezug durch eine Vielzahl von Markierungen besonders hervorhebt. Der Kollege wird zum eigentlichen Biel-Text Steiners, Biel ist in dieser Erzählung so deutlich Hauptakteur wie der Protagonist selbst. Allerdings wachsen bei den Lesenden im Lauf der Lektüre – ähnlich wie in Strafaufgabe mit Benninger – die Zweifel am Realitätsgehalt der Wahrnehmungen des Protagonisten. Im Unterschied zu Benninger ist Greif zwar nicht selbst der Erzähler, aber als Reflektorfigur im personalen Erzählverhalten einer unpersönlichen Erzählinstanz nimmt nur er wahr, was wir beim Lesen über die Stadt erfahren. In einer für Steiners Schreiben neuen Dichte und dramaturgischen Geschlossenheit führt der Text die Lesenden durch den letzten Tag im Leben Greifs und durch ein Biel, in dem die mit Steiners Werken Vertrauten unter ihnen außer dem Krankenhaus alle wichtigen Schauplätze der Stadt seiner früheren Werke wiedererwähnt finden: Marktgasse, Kanalgasse, Schüsskanal, Schüssbrücke, die Allee, die zum See führt und selbst noch die Tankstelle aus „den siebziger Jahren“ (W3, 390), die längst der Verbreiterung der Durchgangsstraße nach Neuchâtel hat weichen müssen. Als Ausgeschlossener und Abgeschriebener sieht Greif sich schon sozial überfahren, bevor ihm dies bei einem fast beiläufig erzählten Autounfall auch physisch geschieht und den Tod bringt. Sein Bemühen, dem sozialen Tod zu entgehen lässt ihn bei seinem Gang durch die Stadt fast zwanghaft auf der verlorenen Normalität seines einstigen Lebens als Mechaniker in der Firma Alpha beharren. Deshalb bleibt er auch in einem fortdauernden inneren Gespräch mit einem ebenfalls entlassenen Kollegen, der im See ertrunken ist. Ob durch Suizid oder durch einen Unfall, hat Greif nicht in Erfahrung bringen wollen, denn das „hätte den unaufgeklärten Fall zu einem erklärbaren zu einem erledigten Fall gemacht, unwiderruflich.“ (W3, 394)
Die Zurückhaltung, die Greif seinem verstorbenen Kollegen gegenüber bezeugt, verlangt er auch von einem Schriftsteller für sich selbst. Dieser bittet ihn in einer Kneipe darum, ihm gewisse Sätze zu überlassen, die er ihn hat aussprechen hören. „Gewisse Menschen kennen keine Grenzen“ (W3, 405), sagt sich Greif daraufhin. Für ihn ist die Bitte des Schriftsellers ebenso übergriffig wie der Plan eines Kunstmalers, eine Ausstellung „im Bahnhofswartesaal zweiter Klasse“ durchzuführen, damit er „mit seiner Kunst endlich auch jene erreiche, die nie im Leben den Mut hätten, eine Galerie zu betreten.“ (W3, 406) Der Künstler erreicht das genaue Gegenteil: „Greif und sein Kollege mussten kein Wort darüber verlieren, das Bahnhofsareal war während dieser Ausstellung für sie ein Sperrgebiet.“ (W3, 406) Steiner radikalisiert hier die Infragestellung seines eigenen Schreibens über randständige Menschen, die er schon mit dem Protagonisten in Weissenbach und die anderen angesprochen hat. Schriftsteller, die marginalisierte Menschen darstellen, und Künstler, die sie mit ihren Werken ansprechen wollen, geraten in den Verdacht, ihre Gewissensbisse über ihre privilegierte Situation beruhigen zu wollen. Greif will nicht zum Gegenstand „dichterischer Empfindsamkeit“ (W3, 406) von Menschen werden, die wahrscheinlich „in einer großen, mit Fransenteppichen ausgestatteten Wohnung“ (W3, 405) leben. Dieser Problematik trägt Steiner insofern Rechnung, als er dem arbeitslosen Greif über dessen berufliche „Unvermittelbarkeit“ (W3, 388) hinaus auch eine literarische gewährt und Greif zu einem in vielen Hinsichten „unerklärten Fall“ (W3, 394) macht, wie dieser es sich für seinen toten Kollegen wünscht. In distanzierter Sachlichkeit macht der Text ihn nicht zum Gegenstand „dichterischer Empfindsamkeit“, sondern verleiht ihm die Erhabenheit, die Kant der „Absonderung von aller Gesellschaft“ zuspricht, „wenn sie auf Ideen beruht, welche über alles sinnliche Interesse hinweg sehen.“77 Paradoxerweise sondert Greif sich nämlich gerade dadurch von aller Gesellschaft ab, dass er sich krampfhaft darum bemüht, ihr weiterhin anzugehören, und dieses Bemühen „über alles sinnliche Interesse hinweg“ im halluzinatorischen Gespräch mit seinem verstorbenen Kollegen fortsetzt. Das utopische Moment dieser fixen Idee äußert sich am deutlichsten im Spruch: „Der Osterhase kriecht bestimmt aus der Erde“ (W3, 405), den Greif dem Schriftsteller nur freigeben will, wenn er zuerst „den Kollegen fragen“ (W3, 405) kann. Das Bild des Osterhasen zeigt sich Greif dann erst, als er im Sterben sieht, wie sein Kollege diese Figur schlittschuhlaufend ins Eis des zugefrorenen Sees ritzt, „die Ohrenspitzen beim Beau-Rivage, die Pfoten drüben am Südufer beim Seewasserwerk.“ (W3, 428)
Die so beschaffene Erhabenheit Greifs liegt der paradoxen Erscheinung der Stadttopographie Biels in Der Kollege zugrunde, wie Heinz Schafroth sie im eingangs zitierten Aufsatz folgendermaßen charakterisiert hat:
Wer die Straßen kennt, die von Biels Altstadt oder der Innenstadt an den Bahnhof und den See führen, sollte es bei Gelegenheit überprüfen: wie fremd sie ihm auf einmal werden können und müssen, wenn er sich bewusst macht, wie der arbeitslose Bernhard Greif sie gegangen ist, nach einer unverrückbaren Wochenplanung, immer zur gleichen Zeit, Tag für Tag, bis einer der Tage unangekündigt sich als der letzte herausstellte.78
Fremd müssen die über Greifs Sicht- und Denkweise wahrgenommen Gegebenheiten der Stadt heutigen empirischen Leserinnen und Lesern auch deshalb vorkommen, weil Greif beim Gang durch die Stadt vor allem auch von seiner verlorenen Vergangenheit zehrt:
Greif rettet sich in die Erinnerungen an die Straße, in der er selbst aufgewachsen ist. Das Wäldchen dort, in dem er ganze Tage zugebracht hat wie ein gehetztes Tier, ist gerodet worden. Eine Versicherungsgesellschaft hat Mietwohnungen in den gesprengten Fels gebaut. Kindern, die sich verstecken wollen, bleibt heute als Versteck nur noch der auf dem Vorplatz stehende Abfalleimer.
„Oder eine Schule wie dieses Gymnasium“, sagt Der Kollege. (W3, 401)
Zu den Orten, die Greif mit seinem imaginären Kollegen durch die Stadt besucht, gehört tatsächlich auch die Mensa im Kellergeschoss des Gymnasiums:
Das Leben im Gymnasium spielt sich unterirdisch ab.
Erst nach der Matur erblicken die Schüler das Licht der Welt. […] Schon bald sehnen sie sich in das gedämpfte, schutzgewährende Halbdunkel ihres Schulhauses zurück. […] Sie beginnen, an der Ahnung, eine Heimat verloren zu haben, zu leiden und an sich selbst zu zweifeln. (W3, 400)
Dass Greif seine eigenen regressiven Wünsche auf die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten projiziert ist unübersehbar. Damit macht Steiner deutlich, dass die Motive für die Städtebilder des sesshaften Schriftstellers, der nach Benjamin „ins Vergangene statt ins Ferne reist“79, auch regressiv sein könnten. Steiners Text lässt das erkennen und nimmt der Regression sogleich jede verheißungsvolle Konnotation, indem Greifs Kollege das schutzbietende Gymnasium mit dem Versteck des auf dem Vorplatz stehenden Abfalleimers vergleicht, ein Vergleich, der die Lesenden unweigerlich an die Abfalleimer von Nagg und Nell in Becketts Endspiel erinnert und damit an eine Regression, die einer endlosen Agonie gleichkommt. Die Ausweglosigkeit von Greifs Situation zeigt sich in der Stadttopographie Biels vielleicht am deutlichsten in seinem Blick auf den Zentralplatz der Stadt, ein „Verkehrsknotenpunkt“ mit einem „Durcheinander von Hinweis-, Gebots- und Verbotstafeln“ (W3, 408), das die Verkehrsteilnehmer verwirrt:
Uneingeweihte können nicht erkennen, dass der Platz das Zentrum der Stadt bildet. Biel-Bienne ist eine Stadt ohne Mitte. Heruntergekommene Häuser geben den Blick in unbestimmtes Gelände frei.
„Wie in einer Banlieue von Paris“, hat der Kollege einmal gesagt. (W3, 409)
Das Zentrum der Kleinstadt am Jurasüdfuß erscheint so ortlos wie die Allerweltslandschaft der Banlieue einer Weltstadt.
Gegenorte
Wer tanzt schon zu Schostakowitsch, im Jahr 2000 erschienen, steht bezüglich des Bielbezugs noch einmal im Gegensatz zum vorhergehenden Buch. Während Biel dort in allen typischen Merkmalen seiner Stadttopographie vergegenwärtigt wird, beschränkt sich der Schauplatz dieser Erzählung nun auf den Arbeitsort des einen Protagonisten, Goody Eisinger, auf das „Museum für Vorgeschichte“ (W4, 11) und seine nähere Umgebung: die zum See führende Allee und der Kanal, der ebenfalls zum See führt, beides Kennzeichen der Bieler Stadttopographie, die schon in mehreren Texten Steiners vorgekommen sind. Sie gehören zum „Arbeits- und Freizeitweg“ (W4, 21) des anderen Protagonisten, des jüngeren Bruders von Goody, der dessen ganzen Lebenswandel mit argwöhnischem Neid verfolgt, alles aufschreibt, „was mit Eisinger zu tun hat“ (W4, 29), und nach dessen mysteriösem Verschwinden seine Rolle in der Stadt übernehmen will. Der Vater der beiden war „beim Tiefbau beschäftigt“ und zeitlebens „für die Kanalisation der Stadt verantwortlich“ (W4, 36), ähnlich wie Steiners Vater gemäß seiner Dankesrede von 2002 zur Verleihung des Max-Frisch-Preises 2002 (vgl. W4, 371-374). Schon in Weissenbach und die anderen hat Steiner seinem Vater mit Helfenstein ein Denkmal gesetzt, der ebenfalls im Stadtplanungsamt tätig ist, auch ein Wachstuchheft besitzt, in das „sorgfältig mit farbigen Stiften eingezeichnete, Datum und Straßennamen tragende Bodenprofile“ (W2, 283)80 eingezeichnet sind, und der dazu noch die Silbe „stein“ im Namen trägt. Auf den Autor weist auch die Beschränkung der Stadttopographie auf das Museum, die Allee und den Kanal hin, während Jahren feste Etappen der täglichen Gänge Steiners in die Stadt. In den beiden Brüdern ist viel von Steiner selbst zu finden, in dem älteren, dem sympathischen Phantasten, der gerne Geschichten erzählt und zu Musik von Schostakowitsch tanzt81, und dem jüngeren, der einen bürgerlichen Lebenswandel führt, den älteren um dessen Lebensweise ebenso beneidet wie er sie in Frage stellt – unter anderem eben mit der rhetorischen Frage: „wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch!“ (W4, 69) – , zugleich aber alles über ihn aufschreibt, um ihn nach dessen mysteriösem Verschwinden schließlich zu imitieren.
Schon 1976 hat Steiner in seiner Dankesrede zur Verleihung des Literaturpreises des Kantons Bern gesagt:
[…] ich fing an zu schreiben, Gedichte, Romane, Erzählungen, und ich war betroffen, als meine Freunde mich fragten, warum ich nicht über mich selbst schriebe.
Über mich selbst?
Schrieb ich denn nicht unentwegt über mich selbst? (W4, 356)
Auffällig ist, dass Steiner in Texten, die die Nähe seiner Figuren und Geschichten zu ihm selbst hervortreten lassen, am meisten Abstand von Biel nimmt, wie vor allem in Weissenbach und die anderen, und dass er in solchen, die von gesellschaftlich missachteten und ausgeschlossenen Menschen handeln, die Topographie seiner Heimatstadt in vielen Einzelheiten fassbar werden lässt, wie im Messer für den ehrlichen Finder und – noch deutlicher – im Kollegen. So erstaunt es nicht, dass, wenn er „kaum einmal, explizit eigentlich nur in Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean, von sich geschrieben“82 hat, darauf bedacht war, auch geographisch die größte Distanz zu Biel einzunehmen. Seine Texte mit Bielbezug handeln immer wieder von marginalen Existenzen: Werktätige, immigrierte, arbeitslose und kriminalisierte Menschen bevölkern die Texte, während die Stadtnotablen in Weissenbach und die anderen in einer fingierten Stadt leben und die Intellektuellen in Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean auf einem anderen Kontinent. Biel wird so durchweg als Stadt von Marginalisierten dargestellt und ist selbst insofern marginal, als „die direkte Linie Zürich-Genf […] über Bern“ führt, während Biel, „aufs Ganze gesehen, eine geringfügige Abweichung“ ist, „kaum erwähnenswert und noch lange kein Umweg“ (W3, 90), wie Steiner in Reise durch eine besetzte Gegend 1969 festhält. Der Text lässt die Marginalität von Biel in paradoxaler Doppeldeutigkeit erscheinen, denn „kaum erwähnenswert“ kann sowohl auf die abseits der direkten Linie liegende Stadt bezogen werden wie auf die „geringfügige Abweichung“, Biel ist marginal, „aber noch lange kein Umweg“.
Von der fingierten Stadt Otterwil hat Heinz Schafroth geschrieben, sie verwandle „sich zeitweise in einen Nicht-Ort, was bekanntlich die Übersetzung von Utopie ist“ (zit. nach W2, 463). Biel hingegen ist in Steiners Texten Ort und Nicht-Ort zugleich, denn die Stadt erscheint darin wie der Belbo bei Pavese zugleich als real gegeben und als Ort der Geschichten, die über sie erzählt werden. Und auch als Ort der Geschichten hat sie einen paradoxalen Doppelcharakter: Sie bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie den Lesenden der Texte, die sie darstellen, im Sinn der heutigen Städtebautheorien „kognitive und emotionale Anhaltspunkte im individuellen und kollektiven Gedächtnis“ und wird ein „Teil der menschlichen Identität“83, die in ihnen gesucht wird, ist aber andererseits die „Stadt ohne Mitte“ (W3, 408), die solche Anhaltspunkte hat verschwinden lassen und den in ihnen lebenden Menschen eine Identitätsbildung erschwert. Das Text-Biel Steiners gleicht immer wieder den Städten, von denen er 1976 in der schon zitierten Rede zur Verleihung des Literaturpreises des Kantons Bern sagte: „Wir wohnen in unseren Städten, als wären sie von Weltraumspinnen ausgelegt worden, und von Krisen und von Arbeitslosigkeit reden wir, als handle es sich um Höhere Gewalt.“ (W4, 359) Genau so erleben die marginalisierten Menschen, die Steiner in seinem Text-Biel auftreten lässt, die Krisen, die sie aus der Gesellschaft aussortieren, und die Entwicklung ihrer Stadt, die Netze entstehen lässt, die sie gleichzeitig festhalten und der Entfremdung von sich selber, ihren Mitmenschen und der Natur aussetzen.
Dieser Stadt setzt Steiner immer wieder jene „Gegenräume“84 entgegen, die Michel Foucault als Heterotopien bezeichnet und nach Krisen- und Abweichungsräumen eingeteilt hat.85(Foucault, 12). Eine Abweichungsheterotopie bilden das Krankenhaus in Eine Stunde vor Schlaf und in Das Netz zerreißen und die Haftanstalt Brandmoos in Strafarbeit und in Ein Messer für den ehrlichen Finder. Das sind Orte, „welche die Gesellschaft an ihren Rändern unterhält, […] für Menschen gedacht, die sich im Hinblick auf den Durchschnitt oder die geforderte Norm abweichend verhalten.“86 Dazu gehört auch das „Bordell in Biel“ (W1, 223), das Schoses Mutter besitzt und in dem er in seiner Kindheit und Jugend wohnt. Als Freudenhaus offenbart es nach Foucault sogar „das eigentliche Wesen der Heterotopien. Sie stellen alle anderen Räume in Frage […], indem sie eine Illusion schaffen, welche die gesamte übrige Realität als Illusion entlarvt“87. Eine Abweichungsheterotopie bildet ebenfalls die Schönegg in Das Netz zerreissen insofern, als dieses Restaurant der Treffpunkt von Menschen ist, die sich von der Gesellschaft ausgeschlossen sehen: Schlachthausarbeiter, Immigranten, Arbeitslose und Pensionierte. Eine Krisenheterotopie hingegen bilden das Gymnasium und seine Mensa in Der Kollege, denn hier befinden sich Jugendliche in einem biologischen und biographischen Übergangsstadium und erleben „ganz real einen anderen realen Raum […], der im Gegensatz zur wirren Unordnung unseres Raumes eine vollkommene Ordnung aufweist.“88 Zu den „Heterotopien der Zeit“89 schließlich kann man das Museum zählen, in dem Goody Eisinger in Wer tanzt schon zu Schostakowitsch als Aufseher arbeitet. Das Museum verwirklicht nach Foucault die Idee der Moderne, „alles zu sammeln und damit gleichsam die Zeit anzuhalten oder sie vielmehr bis ins Unendliche in einem besonderen Raum zu deponieren […], als könnte dieser Raum selbst endgültig außerhalb der Zeit stehen […].90 Gemäß dieser Definition könnte man auch das Söckelchen in Weissenbach und die anderen als Heterotopie der Zeit betrachten, denn der leere Sockel macht aus dem Platz der Freiheit insofern einen „Raum aller Zeiten“91, als alle Statuen und Kunstwerke, die einmal auf ihm standen, sukzessive weggeräumt wurden und er so auf paradoxe Weise das Gedenken an sie perpetuiert. Zur wohl wichtigsten Heterotopie in Steiners Werk jedoch werden die „Gärten des Jahres 1943 in der Schweiz“ (W1, 169). Ihre Blumen, Büsche und Bäume werden nach 1945 gewiss immer mehr der Verbreiterung der Straßen und dem Bau von Hochhäusern geopfert, finden sich aber in den meisten Texten mit Bielbezug bis zu Wer tanzt schon Musik von Schostakowitsch wieder. Der Garten aber bietet auch in der Weltgeschichte „das älteste Beispiel einer Heterotopie“92, sagt Foucault und präzisiert: „Der Garten ist seit der frühesten Antike ein Ort der Utopie“93, aber eben ein Ort, den es wirklich gibt. Doch gerade an der faktischen Wirklichkeit wecken Steiners Texte im gleichen Maße Zweifel, wie sie sich auf sie beziehen, denn: „Die Gärten in der Marktgasse: hat es da je Gärten gegeben? Es ist erlaubt zu fragen; man möchte die Wahrheit wissen.“ (W1, 181) Für die Wahrheit der Gärten gilt wie für jene der Stadt Biel und wie für die Geschichten von Goody Eisinger: „Dass die Wahrheit eine Geschichte ist, heute eine andere als morgen, ist nur natürlich. […] Würde sie sich nicht verwandeln, wie alles, was lebt, müsste man sagen, die Wahrheit sei tot.“ (W4, 11)
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Die im Aufsatz zitierten Texte von Jörg Steiner sind hier nicht einzeln aufgeführt. Sie werden im Lauftext mit Titel und Erscheinungsjahr und mit Verweisen auf die Seitenzahlen in den vier Bänden der Gesammelten Werken im Suhrkamp Verlag genannt.
Jörg Steiner: Gesammelte Werke. Herausgegeben von Martin Zingg. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2021
Werke 1. Romane
Strafarbeit. Ein Messer für den ehrlichen Finder
Werke 2. Romane
Das Netz zerreißen
Weissenbach und die anderen
Werke 3. Erzählungen
Auf dem Berge Sinai sitzt der Schneider Kikeriki
Schnee bis in die Niederungen
OLDUVAI
Fremdes Land
Der Kollege
Werke 4. Erzählungen, Geschichten, Essays, Reden
Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch
Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean
Eine Stunde vor Schlaf
Abendanzug zu verkaufen
Geschichten, Essays, Reden
Sekundärliteratur
Dieter Bachmann: „Ganze Tage an Mauern und Geländern“. In: Auch das könnte wahr sein. Hommage an den Geschichtenerzähler Jörg Steiner. Hgg. von Rolf Hubler und Hans Ruprecht. Zürich: Rotpunktverlag, 2014, S. 23-31.
Walter Benjamin: „Die Wiederkehr des Flaneurs“. In: Ders.: Gesammelte Schriften III. Hgg. von Hella Tiedemann-Bartels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1972, 194-199.
Peter Bichsel: Der Leser. Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand, 1982.
Peter Bichsel: Das süße Gift der Buchstaben. Reden zur Literatur, Frankfurt a. M, Suhrkamp Verlag 2004.
Bieler Geschichte. Band 2. 1815 bis heute. Hgg. von der Stadt Biel unter der Leitung von David Gaffino und Reto Lindenegger. Baden: hier+jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2013.
Anne Brandl: Die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum. Städtebautheoretische Überlegungen. DISS. ETH Nr. 21434. Zürich : ETH, 2013, S. 187. Fassbar in: https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/79706/eth-8025-02.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Zugriff 29.02.2024).
Umberto Eco: Im Wald der Fiktionen. Sechs Streifzüge durch die Literatur. Aus dem Italienischen von Burkhard Kroeber. München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1994.
Michel Foucault: Die Heterotopien. Les hétérotopies. Der utopische Körper. Le corps utopique. Zweisprachige Ausgabe. Übersetzt von Michael Bischoff. Mit einem Nachwort von Daniel Defert. Frankfurt a, Main: Suhrkamp Verlag, 2005.
Gerhard Hoffmann: Raum, Situation, erzählte Wirklichkeit. Poetologische und historische Studien zum englischen und amerikanischen Roman. Stuttgart: Metzler, 1978.
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie. Werke in sechs Bänden. Band V. Hgg. von W. Weischedel. Wiesbaden: Insel Verlag, 1957.
Katja Lange-Müller: „Mit einem Handschuh im Wald“. In: Auch das könnte wahr sein. Hommage an den Geschichtenerzähler Jörg Steiner. Hgg. von Rolf Hubler und Hans Ruprecht. Zürich: Rotpunktverlag, 2014, S. 59-66.
Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Aus dem Englischen von Gustav Roßler. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007.
Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte. Formen und Funktionen diskursiver Stadtkonstitution“. In: Ders. (Hg.): Stadtbilder. Allegorie Mimesis Imagination. Heidelberg: C. Winter, 1999, S. 11-36.
Robert Musil: „Denkmale“. In: Ders.: Gesammelte Werke 7. Kleine Prosa Aphorismen Autobiographisches. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag, 1978, S. 506-509.
Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen: Wallstein Verlag, 2008.
Daniel Rothenbühler: „,Er ist, was er ist.‘ Das Erhabene des Erwerbslosen bei Jörg Steiner, Paul Nizon und Eleonore Frey“. In: Zygmunt Mielczarek (Hg.): Flucht und Dissidenz. Außenseiter und Neurotiker in der Deutschschweizer Literatur. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 1999, S. 151-163.
Heinz Schafroth: „Nachwort. Geschichten gegen die Gewöhnung“. In: Jörg Steiner: Eine Giraffe könnte es gewesen sein. Geschichten. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1979, S. 68-76.
Heinz Schafroth: „Literatur und Sesshaftigkeit. Über Paul Nizon, Gerhard Meier, Jörg Steiner z. B.“. In: Berner Almanach. Band 2. Literatur. Hgg. von Adrian Mettauer, Wolfgang Pross und Reto Sorg unter Mitarbeit von Sabine Künzi. Bern: Stämpfli Verlag, 1998, S. 355-360.
Elisabeth Ströker: Philosophische Untersuchungen zum Raum. [1965] Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977.
Daniel Weber: Jörg Steiner. Eine Monographie. Dissertation. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft, 1988.
Sigrid Weigel: Topographien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1990.
Jacob Zimmerli: Die deutsch-französische Sprachgrenze in der Schweiz. 1. Teil. Die Sprachgrenze im Jura. Basel, Genf: Verlag von H. Georg, 1891.
Webseite
https://search.ortsnamen.ch/de/record/802000371 (Zugriff 29.02.2024).
https://www.srf.ch/play/tv/antenne/video/cite-marie?urn=urn:srf:video:9a491a37-c97c-4c62-a2a7-fe6c0e6b7e6b (Zugriff 29.02.2024).
https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3calo#:~:text=Z%C3%B3calo%20(dt.%3A%20%E2%80%9ESockel,auf%20den%20Sockel%20abgerissen%0 (Zugriff 29.02.2024).
https://www.tinguely.ch/de/ausstellungen/ausstellungen/2010/rotozaza.html (Zugriff 29.02.2014).
https://www.luginbuehlbernhard.ch/werke/eisen/atlas/index.html (Zugriff 29.02.2024)
https://de.wikipedia.org/wiki/Auto-Partei (Zugriff 29.02.2024).
- Heinz Schafroth: „Literatur und Sesshaftigkeit. Über Paul Nizon, Gerhard Meier, Jörg Steiner z. B.“. In: Berner Almanach. Band 2. Literatur. Hgg. von Adrian Mettauer, Wolfgang Pross und Reto Sorg unter Mitarbeit von Sabine Künzi. Bern: Stämpfli Verlag, 1998, S. 355-360, hier S. 358. ↩
- Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur. Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen: Wallstein Verlag, 2008, S. 127. ↩
- Ebd., S. 23. ↩
- Ebd. ↩
- Daniel Weber: Jörg Steiner. Eine Monographie. Dissertation. Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft, 1988, S.20. ↩
- Piatti, wie Anm. 2, S. ↩
- Dieter Bachmann: „Ganze Tage an Mauern und Geländern“. In: Auch das könnte wahr sein. Hommage an den Geschichtenerzähler Jörg Steiner. Hgg. von Rolf Hubler und Hans Ruprecht. Zürich: Rotpunktverlag, 2014, S. 23-31, hier S. 26-27. ↩
- Schafroth, wie Anm. 1, S. 358. ↩
- Ebd. ↩
- Heinz, Schafroth: „Nachwort. Geschichten gegen die Gewöhnung“. In: Jörg Steiner: Eine Giraffe könnte es gewesen sein. Geschichten. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1979, S. 68-76, hier S. 71. ↩
- Wie hier wird mit W, Bandnummer, Seitenzahl wie im Folgenden auf Jörg Steiner: Gesammelte Werke 1-4. Hgg. von Martin Zingg. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2021 verwiesen. ↩
- Walter Benjamin: „Die Wiederkehr des Flaneurs“. In: Ders.: Gesammelte Schriften III. Hgg. von Hella Tiedemann-Bartels. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1972, 194-199, hier S. 194. ↩
- Schafroth, wie Anm. 1, S. 355. ↩
- Ebd., S. 355-356. ↩
- Ebd., S. 356. ↩
- Ebd., S. 358. ↩
- Ebd., S. 360. ↩
- Schafroth, wie Anm. 10, S. 72. ↩
- Ebd., S. 73. ↩
- Sigrid Weigel: Topographien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1990, S. 209. ↩
- Zit. nach Weber, wie Anm. 5, S. 42-43. ↩
- Ebd., S. 42. ↩
- Vgl. ebd., S. 47. ↩
- Ebd., S. 48. ↩
- Schafroth, wie Anm. 1, S. 358. ↩
- Vgl. Peter Bichsel: Das süße Gift der Buchstaben. Reden zur Literatur, Frankfurt a. M, Suhrkamp Verlag 2004, S. 19: „Ich beschreibe nicht den Tisch, sondern ich schreibe Sätze, die es über einen Tisch zu sagen gibt. ,Was sagen die Leute von einem Tisch?‘ und nicht ,Was ist ein Tisch?‘ Mich interessiert nicht die Wirklichkeit, sondern das Verhältnis zu ihr.“ ↩
- Vgl. Jacob Zimmerli: Die deutsch-französische Sprachgrenze in der Schweiz. 1. Teil. Die Sprachgrenze im Jura. Basel, Genf: Verlag H. Georg, 1891, S. 41: „Der Ort ist offenbar eine deutsche Gründung und der Name nichts anderes als das deutsche Bühl: Hügel.“ Diese Deutung ist heute widerlegt, vgl. https://search.ortsnamen.ch/de/record/802000371 (Zugriff 29.02.2024). ↩
- Weber, wie Anm. 5, S. ↩
- Ebd. ↩
- Ebd., S. 22 ↩
- Ebd. ↩
- Ebd., S. 24. ↩
- Ebd. ↩
- Die Begriffe Anschauungsraum, Aktionsraum und Stimmungsraum hat die Literaturwissenschaft aus der Phänomenologie übernommen. Vgl. Gerhard Hoffmann: Raum, Situation, erzählte Wirklichkeit. Poetologische und historische Studien zum englischen und amerikanischen Roman. Stuttgart: Metzler, 1978, S. 47-48. Zum Anschauungsraum vgl. Elisabeth Ströker: Philosophische Untersuchungen zum Raum. [1965] Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977, S. 93-96. ↩
- Vgl. Ströker, wie Anm. 34, S. 54-58. ↩
- Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie. Aus dem Englischen von Gustav Roßler. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007, S. 313. ↩
- Ebd. Latour spielt hier auf die „oligo-éléments“ an, die auf Deutsch Spurenelemente genannt werden. ↩
- Ebd., S. 326-327. ↩
- Ebd., S. 327. ↩
- Umberto Eco: Im Wald der Fiktionen. Sechs Streifzüge durch die Literatur. Aus dem Italienischen von Burkhard Kroeber. München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1994, S. 95. ↩
- Ebd., S. 96. ↩
- Ebd. ↩
- Ebd. ↩
- Ebd. ↩
- Weber, wie Anm. 5, S. 52. ↩
- Andreas Mahler: „Stadttexte – Textstädte. Formen und Funktionen diskursiver Stadtkonstitution“. In: Ders. (Hg.): Stadtbilder. Allegorie Mimesis Imagination. Heidelberg: C. Winter, 1999, S. 11-36, hier S. 15. ↩
- Ebd. ↩
- Piatti, wie Anm. 2, S. 186. ↩
- Ebd., S. 34. ↩
- Vgl. Bieler Geschichte. Band 2. 1815 bis heute. Hgg. von der Stadt Biel unter der Leitung von David Gaffino und Reto Lindenegger. Baden: hier+jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, 2013, S. 916, und https://www.srf.ch/play/tv/antenne/video/cite-marie?urn=urn:srf:video:9a491a37-c97c-4c62-a2a7-fe6c0e6b7e6b (Zugriff 29.02.2024). ↩
- Dieses Bild deutet zudem an, woher Benninger die Idee hat, seine Flucht aus der Haftanstalt als phantastischen Ritt auf einem Hund zu erzählen, der den Bielersee durchschwimmt und ihn so von Brandmoos nach Biel bringt, vgl. W1, 19-23. ↩
- Vgl. Ströker, wie Anm. 34, S. 22-24. ↩
- Ebd., S. 22-23. ↩
- Mahler, wie Anm. 46, S. 15. ↩
- Weber, wie Anm. 5, S. 60. ↩
- Ebd., S. 59. ↩
- Ebd., S. 64. ↩
- Weber, wie Anm. 5, S. 64-65. ↩
- Eco, wie Anm. 40, S. 17. ↩
- Ebd. ↩
- Ebd., S. 112. ↩
- Ebd., S. 114. ↩
- Weber, wie Anm. 5, S. 55. ↩
- Ebd., S. 54. ↩
- Vgl. Bieler Geschichte, wie Anm. 50, S. 962-964. ↩
- Siehe oben zu Anm. 6 ↩
- Siehe oben zu Anm. 6 ↩
- Vgl. Peter Bichsel: Der Leser. Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand, 1982, S. 11: „Während ich Geschichten erzähle, beschäftige ich mich nicht mit der Wahrheit, sondern mit den Möglichkeiten der Wahrheit. Solange es noch Geschichten gibt, so lange gibt es noch Möglichkeiten.“ ↩
- Im persönlichen Gespräch sagte Jörg Steiner mir 1994 anlässlich der Publikation von Weissenbach und die anderen, er habe schon immer die leise Furcht gehabt, jemand aus Biel könnte sich einmal durch eines seiner Bücher betupft fühlen und ihn gerichtlich belangen. Mit Außenseitern und Randfiguren ist diese Gefahr kleiner als mit stadtbekannten Persönlichkeiten. ↩
- Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3calo#:~:text=Z%C3%B3calo%20(dt.%3A%20%E2%80%9ESockel,auf%20den%20Sockel%20abgerissen%0 (Zugriff 29.02.2024). ↩
- Vgl. https://www.tinguely.ch/de/ausstellungen/ausstellungen/2010/rotozaza.html (Zugriff 29.02.2014). ↩
- Vgl. https://www.luginbuehlbernhard.ch/werke/eisen/atlas/index.html (Zugriff 29.02.2024) ↩
- Robert Musil: „Denkmale“. In: Ders.: Gesammelte Werke 7. Kleine Prosa Aphorismen Autobiographisches. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag, 1978, S. 506-509, hier S. 506-507 und 509. ↩
- Ebd., S. 507. ↩
- Anne Brandl: Die sinnliche Wahrnehmung von Stadtraum. Städtebautheoretische Überlegungen. DISS. ETH Nr. 21434. Zürich : ETH, 2013, S. 187. Fassbar in: https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/79706/eth-8025-02.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Zugriff 29.02.2024). ↩
- Literarischer Deckname für die Auto-Partei, die 1985 gegründet wurde, 1991 Fraktionsstärke im Nationalrat erlangte und 1994 in Freiheitspartei umbenannt wurde, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Auto-Partei (Zugriff 29.02.2024). ↩
- Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie. Werke in sechs Bänden. Band V. Hgg. von W. Weischedel. Wiesbaden: Insel Verlag, 1957, S. 367. Vgl. dazu auch: Daniel Rothenbühler: „,Er ist, was er ist.‘ Das Erhabene des Erwerbslosen bei Jörg Steiner, Paul Nizon und Eleonore Frey“. In: Zygmunt Mielczarek (Hg.): Flucht und Dissidenz. Außenseiter und Neurotiker in der Deutschschweizer Literatur. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 1999, S. 151-163. ↩
- Schafroth, wie Anm. 1, S. 358. ↩
- Benjamin, wie oben Anm. 12, S. 194. ↩
- Vgl. in der Dankesrede von 2002 das „Wachstuchheft mit von Hand gezeichneten Bodenprofilen“ von Steiners Vater (W4, 373). ↩
- Bei einer Lesung aus Wer tanzt schon zu Schostakowitsch hat Steiner um 2000 fast nebenbei von einem Autor erzählt, der in seinem Schreibbüro in der Bieler Altstadt manchmal zu Musik von Eric Satie tanze. ↩
- Katja Lange-Müller: „Mit einem Handschuh im Wald“. In: Auch das könnte wahr sein. Hommage an den Geschichtenerzähler Jörg Steiner. Hgg. von Rolf Hubler und Hans Ruprecht. Zürich: Rotpunktverlag, 2014, S. 59-66, hier S. 64. ↩
- Brandl, wie Anm. 74, S. 196. ↩
- Michel Foucault: Die Heterotopien. Les hétérotopies. Der utopische Körper. Le corps utopique. Zweisprachige Ausgabe. Übersetzt von Michael Bischoff. Mit einem Nachwort von Daniel Defert. Frankfurt a, Main: Suhrkamp Verlag, 2005, S. 10. ↩
- Vgl. ebd., S. 12. ↩
- Ebd. ↩
- Ebd., S. 19. ↩
- Ebd., S. 19-. ↩
- Ebd., S. 16. ↩
- Ebd. ↩
- Ebd. ↩
- Ebd., S. 14-15. ↩
- Ebd., S.15. ↩