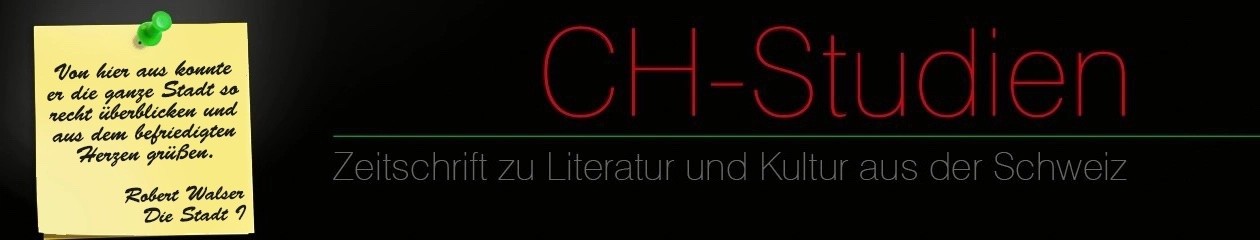Ulrich Weber, Schweizerisches Literaturarchiv Bern
In Ulrich Webers Analyse der Rolle der Vögel im Werk des Schriftstellers und Psychiaters Walter Vogt unter Einbezug des Nachlasses im Schweizerischen Literaturarchiv wird die Beziehung zwischen persönlichem Interesse und literarischer Praxis beleuchtet. Vogts Werke sind bekanntlich stark von seinen biografischen Erfahrungen als Röntgenarzt und Psychiater geprägt, doch spiegeln sie ebenfalls sein lebenslanges Interesse für die Ornithologie wider. Weber führt Vogts anfängliche Beobachtungen von Vögeln in der Kindheit und seine beachtenswerten ornithologischen Publikationen in der Jugend aus und verfolgt anschließend die Frage, wie sich diese Kenntnisse im literarischen Werk ausdrücken und welche literarische Funktion sie übernehmen.Ein zentrales Anliegen Vogts beim Einbezug von Vögeln in sein Werk scheint die kritische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Verhältnis zur Natur, insbesondere der Bedrohung durch Pestizide und den allgemeinen Zivilisationsdruck. Besonders hervorzuheben sind etwa die satirischen Elemente, die Vogt in Geschichten wie Diät und Ornizid verwendet, um den kurzsichtigen und zerstörerischen Umgang mit Umweltgiften anzuprangern. Daneben thematisiert Webers Untersuchung die Verbindung von Wissen und Wahn in Vogts Texten wie Der Vogel auf dem Tisch und Die roten Tiere von Tsavo, wobei der vordergründig kranke psychische Zustand der Protagonisten im Zeichen der «Dialektik der Aufklärung» einer Spiegelung von Wissen und Wahn Raum gibt.Schließlich wird die Topik der Vögel insbesondere im Roman Altern mit seiner Auflösung der Grenzen zwischen Mensch und Natur als eine frühe Reflexion im Zeichen des aktuellen Diskurses des animal turn verstanden. Webers Analyse verdeutlicht, dass Vogts literarisches Schaffen eine Synthese aus persönlicher Passion, wissenschaftlicher Akribie, literarischem Spiel und Zivilisationskritik darstellt, die es ermöglicht, komplexe Zusammenhänge zwischen Mensch, Tier und Umwelt zu erfassen.
Schlüsselwörter
Walter Vogt, animal studies, Ornithologie und Literatur, Ökologie und Literatur, ZivilisationskritikVogt’s Birds
In Ulrich Weber’s analysis of the role of birds in the works of the writer and psychiatrist Walter Vogt, using the estate preserved in the Swiss Literary Archive, the relationship between personal interest and literary practice is illuminated. Vogt’s works are known to be strongly influenced by his biographical experiences as an X-ray doctor and psychiatrist; however, they also reflect his lifelong interest in ornithology. Weber outlines Vogt’s initial observations of birds during his childhood and his noteworthy ornithological publications in youth, subsequently exploring how this knowledge is expressed in his literary work and the literary functions it serves.A central concern for Vogt when incorporating birds into his work appears to be a critical engagement with the human relationship to nature, particularly the threats posed by pesticides and the general pressures of civilization. Noteworthy are the satirical elements Vogt employs in stories like Diät and Ornizid, where he criticizes the shortsighted and destructive handling of environmental toxins. Additionally, Weber’s investigation addresses the connection between knowledge and delusion in Vogt’s texts, such as Der Vogel auf dem Tisch and Die roten Tiere von Tsavo, where the ostensibly sick psychological state of the protagonists reflects a „dialectic of enlightenment,” allowing for a juxtaposition of knowledge and delusion.Finally, the theme of birds, particularly in the novel Altern, with its dissolution of the boundaries between humans and nature, is understood as an early reflection in the context of the current animal turn discourse. Weber’s analysis highlights that Vogt’s literary creation represents a synthesis of personal passion, scientific rigor, literary playfulness, and criticism of civilization, enabling a complex understanding of the interrelations between humans, animals, and the environment.Keywords
Walter Vogt, animal studies, ornithology and literature, ecology and literature, criticism of civilisation
Wie hängt Literatur und deren Entstehung mit biografischen und lebensweltlichen Kontexten und Voraussetzungen zusammen? Wie geht Wissen aus Beruf und Alltag in Literatur ein? Wo liegen die Grenzen zwischen pragmatischen Texten und der ästhetischen Eigenwelt der Literatur? Schriftstellerinnen- und Schriftstellernachlässe sind besonders geeignet, derartige Fragen und die Grenzbereiche der Literatur empirisch und exemplarisch zu untersuchen. Bei einem Autor, der wie Walter Vogt sein Werk weitgehend aus dem eigenen privaten und beruflichen Erfahrungsraum schöpft ‒ bis hin zu Drogenexperimenten und -entziehungskur ‒ und zugleich eine Vorliebe für autofiktionale Verwirrspiele zeigt, sind diese Fragen von besonderem Interesse.
Walter Vogt war Röntgenarzt und Psychiater, bevor er Mitte der 1960er Jahre als fast vierzigjähriger Schriftsteller mit Publikationen wie Husten und Wüthrich, Satiren auf seine ärztliche Erfahrungswelt, bekannt wurde. Doch seinen ersten gedruckten Text veröffentlichte er viel früher, am 15. November 1941 als Vierzehnjähriger in der Zeitschrift Der Schweizer Schüler2. Es ist ein Bericht über eine Entenmutter mit ihren Jungen, die sich in der Elfenau bei Bern aufhielt. Man merkt bei der Lektüre sogleich, dass nicht eine zufällige Beobachtung am Teich geschildert wird, dass die Vögel vielmehr durch einen jungen Hobby-Ornithologen gezielt aufgesucht wurden, erwähnt er doch, dass er bereits um 6 Uhr morgens am Teich war. Walter Vogt war in der Tat bereits als Jugendlicher in der Nachbarschaft in Muri bei Bern für seinen unverkennbaren Ornithologengang bekannt.3
Als Sechzehnjähriger zeigt er sich bereits als fundierter Vogelkenner, wenn er im Ornithologischen Beobachter4 ‒ einer Zeitschrift, deren Abonnement er bis an sein Lebensende beibehalten wird5 ‒ über das Brutverhalten von Amsel und Bluthänfling im heimischen Garten berichtet und dabei sehr genaue Beobachtungen über Nestbau, Paarung, Zeitpunkt des Eierlegens, Territoriums- und Jungenverteidigung, Fütterung und Ausflug der Jungen macht, wobei er auch Fachliteratur einbezieht.6 Und ein Jahr später publiziert er im gleichen Organ systematische Beobachtungen über die Reviere von Wasseramseln an der Aare in seiner Wohngemeinde; er kartiert die 16 Reviere auf einer Flussuferlänge von drei Kilometern.7 Im gleichen Jahr folgt noch ein Bericht über Feldbeobachtungen von Wiedehopfen.8 Und zu Weihnachten 1947 widmet der zwanzigjährige Walter Vogt seinem Vater ein 11 Seiten langes, dicht beschriebenes Typoskript: «Soziale Schlafgewohnheiten von Sturnus vulgaris L.» (es handelt sich um den Star), mit der Bemerkung: «Wird laut Zusicherung von Prof. Hediger im ‚Behaviour’ erscheinen.»9 Der renommierte Zoologe Heini Hediger (1908-1992) war damals Zoodirektor in Basel, und die Zeitschrift Behaviour ist bis heute eine führende internationale Fachzeitschrift für zoologische Verhaltensforschung. ‒ Auch wenn an diesem Punkt die ornithologische Publikationstätigkeit Vogts den erhaltenen Belegen zufolge versiegt ‒ sein Medizinstudium ließ ihm wohl nicht mehr die Zeit dazu ‒ sind die Zeugnisse seiner Leidenschaft für Vögel weiterhin vielfältig.10 Er beobachtet weiter und korrespondiert wiederholt mit der Vogelwarte Sempach ‒ als Arzt erstellt er gar Röntgenbilder einer «verunglückten, wohl angeprallten Zwergrohrdommel» und schlägt deren Publikation im Ornithologischen Beobachter vor.11 Seine Witwe Elisabeth Vogt zeigt beim Besuch 35 Jahre nach dem Tod des Autors12 im einst gemeinsam bewohnten Haus zahlreiche Reminiszenzen seiner anhaltenden Vorliebe für Vögel, Kunstwerke, die er teilweise in seinem Werk erwähnt,13 und Fotos. Sie erinnert sich, wie er sie auf der Hochzeitsreise in den Nationalpark im Engadin führte, da er ihr lieber ein Vogelnest zeigen wollte, statt in die Weite zu schweifen, und sie erzählt auch, wie er sich später während der Ferien in Schweden die Kniescheibe brach, als er einen der seltenen Rothalstaucher gesichtet hatte und zur näheren Beobachtung über Steine kletterte. Die Leidenschaft für Vogelbeobachtung manifestiert sich auch in Vogts nachgelassener Bibliothek im Schweizerischen Literaturarchiv, mit einer ornithologischen Abteilung im Umfang von ca. 70 Publikationen.14 Darin findet sich beispielsweise das zweibändige Schweizer Vogelleben15, das offenbar druckfrisch gekauft und «Unserem lieben Walter zu Weihnachten 1940» von «Papa u. Mutti» geschenkt wurde. Auffallend ist bei der Sichtung der Bestände, dass neben den zahlreichen Publikationen, die Vogt offenbar bereits in der Kindheit und Jugend besessen hat, in den 1970er Jahren ein neuer Schub von ‒ teilweise antiquarischen ‒ Erwerbungen hinzukommt, dass er sich also in dieser Phase erneut intensiver mit Vögeln befasst hat.16
Doch was bedeutet das Wissen über Walter Vogts private Forschungsinteressen für den Zugang zum literarischen Werk und wie hängt beides zusammen? Seine frühe ornithologische Schreibpraxis ist jene präziser Sachprosa ohne literarische Ambition ‒ allenfalls kann man in der Schlussbemerkung des Beobachtungsberichts von 1943 zu den brütenden Amseln im Garten eine selbstironisch-sprachspielerische Dimension erkennen: «Es dürfte immerhin eine recht seltene Verletzungsart sein, von der Amsel gebissen zu sein!»17 In der Tat war er allerdings bereits als Kind auf der doppelten Spur von Forscher und Literat unterwegs, wenn er einerseits den Eltern zu Weihnachten 1939 in zwei blauen DIN-A-6-Notizheften in schöner Schülerschrift eine «Einführung in die Vogelkunde», «Bd. 1: Geschichten, Exkursionen» und «Bd. 2: Einzelbeschreibungen (anhand eigener Beobachtungen)», samt Illustrationen, «Vorwort» und «kleine[m] Nachwort» mit Widmung schenkte, bereits ein halbes Jahr zuvor aber auch zum 40. Geburtstag seiner Mutter in gleichem Format als Autor «W. Vogt» einen «Roman von Tieren» mit dem Titel «Die Waldbewohner» verfasste.18
Vogt ist in der Literatur mit seinen ornithologischen Interessen kein Einzelfall. Im Gespräch ist heute etwa der US-amerikanische Autor, Birder und Umweltschützer Jonathan Frantzen, doch hat die Beziehung von Literatur und Vögeln eine lange Tradition, angefangen mit Aristophanes’ Komödie Die Vögel. Im Gedicht sind die metaphorischen Bilder des Flugs für die Freiheit und des Gesangs für die Poesie seit der Antike bekannt; und ein Gedicht wie Edgar Allan Poes The Raven zeigt auch exemplarisch die düstere Seite der Vogel-Semantik an. Eine Sonderstellung nehmen Texte ein, in denen über eine konventionelle Metaphorik des Vogels hinaus spezifische ornithologische Kenntnisse der Autorin bzw. des Autors zum Ausdruck kommen. Tanja van Hoorn hat die Avifauna aesthetica interdisziplinär zum Gegenstand einer Tagung und einer anschließenden Publikation gemacht. Sie zeigt, wie Friederike Mayröcker oder Bengt Emil Johnson in ihren zeitgenössischen Gedichten kenntnisreich eine Vielfalt von genau wegen bestimmter Eigenschaften einbezogenen Vögeln evozieren. Mit Blick auf historische Beispiele des Zusammenspiels von Ornithologie und Poesie zeigt sie Imitation, Transkription, Kooperation und Modulation19 von Vogelgesang und weiteren Vogel-Eigenschaften und kategorisiert sie als «Ornithophonia, Ornithopoesie und Ornithopoetik»20. ‒ So gilt es, von Fall zu Fall die je spezifische literarische Schreibpraxis über und mit Vögeln ins Auge zu fassen. Ein eigener Typus von Erzählprosa hat aktuell Konjunktur ‒ eine Prosa, in der Vögel «als Vögel, gemäß ihren biologischen Eigenschaften also, am narrativen Ablauf beteiligt sind», und in der der Leser «mit einem spezifischen, naturkundlichen bzw. ornithologischen Wissen über die Tiere» konfrontiert wird, «das in die Texte erkennbar eingearbeitet ist oder dort direkt im Rahmen des fiktiven Geschehens verhandelt wird».21 Diese Form der Prosa greift gegenwärtig vor allem zwei Phänomene auf: Einerseits jenen des Umweltaktivismus, andererseits Formen der Kopräsenz von Gewalt und Ornithologie in Kriegszeiten.
An der Grenze zwischen Liebhaberei und sprachkünstlerischer Verarbeitung liegt Vogts Austausch mit dem befreundeten Berner Schriftsteller-Pfarrer Kurt Marti. Dieser schenkt Vogt den Text «Ornithologie für WaVo»22 und wünscht ihm in einer kleinen Ansprache zu dessen 50. Geburtstag abschließend in Mundart ‒ in Anspielung auf Vogts Roman Der Vogel auf dem Tisch ‒ «no mänge schöne Vogel uf ä Tisch!»23 Und Vogt schenkt Marti zu dessen 60. Geburtstag 1981 ein überschriebenes Exemplar von dessen neodadaistischer «Sprachtraube» PARABURI, deren Titel er zur «Sprachschraube» «PARAMARTI» korrigiert. Vorne klebt er ein buntes Bildchen eines Papageien und hinten eines Kakadu ein. Den Papagei vorne bezeichnet er nonsense-wissenschaftlich als «Mamagallus Gallina BURI / Marty’sche Mamagall», und er gibt da noch humorvoll die angebliche Quelle an: «Aus: Courthe, Mary Feministische Ornithologie das ist: Von denen Fogelinnen. Frankfurt an der Tauber, 1986». Dieser «Mamagallus» singt in einer Sprechblase: «BIRDS don’t come easy to me» ‒ in parodistischer Anlehnung an den damaligen Hit Words mit der repetitiven Anfangszeile «Words don’t come easy to me» ‒ und zu dieser Sprechblase kommt noch in einer Anmerkung hinzu: «aber zu Vögeln fällt uns wenigstens etwas ein».24 Den Kakadu hinten im Buch bezeichnet Vogt als «Cacaducius albus BURI» bzw. «Kakenmatt’s Düdüku(h) auf Aestin einer unbekannten Tropinnenbäumin mit Orchideessen (Citroenis DS spec.)», dabei wohl einerseits anspielend auf die feministische Kritik patriarchalischer Strukturen und ihren sprachlichen Reflex in den 1970er Jahren, was Marti dazu veranlasste, Gott weiblich zu denken, andererseits aber auch auf Friedrich Dürrenmatt, mit dem er selbst befreundet war und mit dem Kurt Marti einst das Gymnasium besucht hatte.
So verfließen also die Grenzen zwischen ornithologischem Interesse und literarischer Praxis in humoristisch-sprachspielerischem Austausch mit dem Schriftstellerfreund. Auch in Vogts publiziertem literarischem Werk spielen Vögel eine wichtige Rolle. Am auffälligsten gewiss dort, wo die Vögel im Titel erscheinen: im Roman Der Vogel auf dem Tisch,25 in Erzählungen wie Ornizid oder Kuckuck26 oder in dem Gedicht Ornithomania.27 Bei genauerem und geduldigem Beobachten findet man sie jedoch ‒ wie in der realen Welt ‒ fast überall. Es kann hier nicht darum gehen, sämtliche Texte Walter Vogts zu verzeichnen und aufzuzählen, in welchen mehr oder weniger gut versteckte Vögel zwischen den Blättern auftauchen. Es sollen vielmehr einige exemplarische Fälle präsentiert werden, aus denen sich das Spektrum der literarischen Funktionen der Vögel und die vielfältigen Formen der Koexistenz von Mensch und Vogel in Vogts Texten abzeichnen.
Oft tauchen bei Vogt Vögel und ihre Beobachtung eher in peripherer Rolle auf, gewissermaßen als Kolorit einer Erzählung. Exemplarisch dafür ist die Kleinbürgersatire «Diät» über die Beziehung von «Papali» und «Mamali» und besonders über «Papalis» Nöte wegen des übergroßen Appetits und Übergewichts und der gemeinsamen durchgeführten Spinat-Eier-Diät. Dort ist etwa von Mamalis Sorge um Eier aus artgerechter Hühnerhaltung die Rede,28 während «Papalis» Aufgabe das ‒ im konkreten Fall versäumte ‒ Füttern der hungernden Vögel im Garten ist, wobei die Vögel ‒ typisch für Vogt — spezifiziert werden: «Ein großer Kernbeißer war jedoch im Bäumchen erschienen und hatte vorwurfsvoll auf den leeren Futterplatz gestarrt. Papali, schuldbewußt, hatte Körnerfutter heraufgeholt und den Körnerfressern gestreut.»29 Anschließend muss er noch einen neuen Meisenring aufhängen: «Als dann ein vorwitziges Rotkehlchen sich als erstes zum Futterhäuschen wagte, fiel Papali ein, daß er das Weichfutter für die überwinternden Insektenfresser vergessen hatte.»30 So wird das Thema der Satire, die differenzierten Ernährungsgewohnheiten zwischen Mamali und Papali, beim Füttern der Vögel variiert.
Wird hier der eigene Erfahrungshintergrund ‒ durchaus auch selbstironisch ‒ für die Charakterisierung des kleinbürgerlichen, zugleich umweltbewussten Habitus verwendet, und die Vogelwelt als Spiegel der Menschenwelt eingesetzt, so geht die titelgebende Erzählung aus dem Band Die roten Tiere von Tsavo tiefer. Dort entwickelt sich ein Sprechstunden-Gespräch zwischen einem Psychiater, der ‒ wie so oft bei Vogt ‒ das «Ich» der Erzählung ist und vordergründig autobiografisch erscheint, und seinem Patienten ‒ konsequent «der Mensch» ‒ genannt, der über eine Reise nach Afrika spricht und besessen ist von den «roten Tieren von Tsavo». Gleich bei dessen erster Bemerkung über den «Weißköpfigen Büffelweber» schließt der Psychiater: «Ein Vogelfreund», worauf der Patient meint: «Denken Sie jetzt nicht, ich spinne!»31 Und weiter:
«Mögen Sie Vögel?» fragte der Mensch.
«Als Psychiater ‒?» fragte ich zurück.
Wir lachten gemeinsam. Die Gemeinsamkeit des Lachens erwies sich alsbald als trügerisch. Wir hatten einstweilen keine gemeinsame Welt.
Außer vielleicht einer kleinen Folie à deux. Dazu kannte ich jedoch die Vögel zu schlecht.32
Diese «folie à deux» ‒ die gemeinsame Spinnerei oder Caprice ‒ bezieht sich auf die Vogelliebhaberei und verweist als «folie» zugleich auf die metaphorische Ebene: Als Psychiater Vögel zu mögen, führt unweigerlich in die metaphorische Dimension des Wahns ‒ oder eben: einen Vogel zu haben oder vom Vogel gebissen zu sein.33 Damit knüpft die Erzählung an den Roman Der Vogel auf dem Tisch an, wo das Tier sowohl konkret als ausgestopfter Wendehals auf dem Schreibtisch des Protagonisten Johannes Lips als auch metaphorisch für den ‚Vogel’ des angeblich psychisch kranken, auf jeden Fall verhaltensauffälligen Mannes steht.
Zugleich entsteht mit dieser Formulierung die Ironie, dass sich die «folie» auf die quasi-wissenschaftliche Beschäftigung mit der Vogelwelt bezieht. In Die roten Tiere von Tsavo kommt das ornithologische Wissen des Autors unter Einbezug der eigenen Bibliothek zur Geltung, allerdings überträgt es der Autor von seinem Alter ego, dem psychiatrischen Ich, auf das Gegenüber des Patienten, während das Ich ‒ kontrafaktisch zum realen Autor ‒ meint, es kenne die Vögel zu schlecht für eine «folie à deux». Als der Patient in der Erzählung den «Kleinen Rotschnabeltoko», «Tockus erythrorynchus» erwähnt, den er bei der Lodge im Tsavo-Nationalpark in Ostafrika gesehen habe, zitiert er einen Vogelführer: «[…] immer nach Williams: ‚Roter Schnabel, weiße Flecken auf den Flügeln, Seite zweihundertzweiundvierzig…’ (…) Der Williams, erfuhr ich, war das gebräuchlichste Buch über die Vögel Ost- und Zentralafrikas. Von den anderthalbtausend nachgewiesenene Arten beschrieb der Williams immerhin an die fünfhundert».34 Damit zitiert er nicht nur ein Buch aus Vogts eigener Bibliothek, sondern bezieht sich auch auf eine Reise, die der Autor selbst gemacht hat.
Die Erzählung entwickelt sich um die Frage nach dem Charakter von Wahnsinn und Vision, wofür die Vögel die Metapher sind ‒ verstärkt durch die wiederholte Bemerkung des Besuchers: «Ich fliege nicht gern».35 Es ist also nicht der Arzt, sondern der psychisch Kranke, der dieses rationale, wissenschaftlich belegte, aus einem echten Buch stammende Wissen einbringt, was dem Klischeebild des Wahns rsp. eines Wahnsinnigen widerspricht. Die Frage nach dem Verhältnis von Wissen und Wahn wird dabei ebenso flirrend wie die Identitäten von Arzt und Patient: Was zunächst als klares Indiz einer psychotischen Störung erscheint ‒ im ersten Satz der Erzählung angesprochen: «Ich habe die roten Tiere von Tsavo gesehen»36, und ebenso in dem Schluss des Arztes wiederholt: «Die roten Tiere von Tsavo, schien es, waren seine Krankheit oder doch sein Problem»37 ‒, wird in der Folge konkretisiert und verliert damit allmählich den Wahn-Charakter: Tsavo ist der größte Nationalpark der Welt, in Kenia. Der Patient fragt weiter: «Können Sie sich das vorstellen: Rote Elefanten, rote Nashörner, rotschwarz gestreifte Zebras ‒?», worauf das Psychiater-Ich reagiert: «Vorstellen konnte ich es mir genau genommen schon, weshalb eigentlich nicht?!»38
Handelt es sich also um eine Phantasie, eine Vision? Und wo liegt die Grenze zur Krankheit? Diese Grenze wird multiperspektivisch in Frage gestellt ‒ Arzt und Patient spiegeln sich in der Frage des Wahnsinns: «Ich vermute, er fragte sich, ob er an den Falschen geraten sei, einen Dummkopf, einen Verrückten.»39 Und diese Spiegelung wird auch auf die narrative Funktion übertragen: «Er schien darauf zu warten, daß ich ihm seine Geschichte erzählte. Möglicherweise hätte ich es gekonnt. So schwer ist das gar nicht. Aber es hat keinen Sinn. Ein Kranker muß selbst auf seine Geschichte kommen.»40
«Einen Vogel haben» ist also vielleicht genauso (oder eher) Charakteristikum imaginativer Kreativität wie krankhaften Realitätsverlusts. Es kommt eine weitere Dimension hinzu: Wenn Vogt seinen Patienten sagen lässt: «Das rote Tier der Apokalypse!»41, kommentiert der Ich-Erzähler und Psychiater: «Dazu war ich wieder zu wenig bibelfest. Ich ließ es offen, ob es das rote Tier der Apokalypse gab oder nicht.»42 Auch hier ‒ wie bei dem ornithologischen Wissen ‒ spaltet sich Vogts große Bibelkenntnis43 in einen unwissenden Arzt und einen wissenden Patienten.
Die Verschiebungen in den Fragen nach Krankheit und Wissenschaft, Vernunft und Wahn bzw. individueller und kollektiver bzw. kultureller Vision nimmt eine weitere Wendung, wenn der Mensch seine apokalyptische Vision als Realität konkretisiert: Der Tod ist rot, weil rot die Farbe der staubtrockenen Erde von Tsavo ist; und die roten Tiere sind am Verhungern, weil die Dürre zu lange dauert und es ihnen nicht möglich ist, den Park zu verlassen: «Können Sie sich das vorstellen, Doktor, die größten lebenden Landsäugetiere am Verhungern, ein jedes mehrere Tonnen von gutem, zusammengeweidetem Fleisch…»44 Es ist also eher Verzweiflung als Wahn, was den Patienten zum Psychiater führt. Und die apokalyptische Vision wird schließlich wiederum auf den menschlichen Umweltdruck zurückgeführt: «Wir haben sie in diesen viel zu kleinen Nationalparks zusammengepfercht, die sie bei Todesstrafe nicht verlassen dürfen. Wir haben den Tsavo-Park gegründet. Dieses gottvergessene Stück Erde wurde ja einzig zum Park erklärt, weil sich wirklich nichts anderes damit anfangen ließ.»45
Die roten Tiere und der Vogel stehen somit nicht nur für die Spiegelung der Grenzen von Wahnvorstellung, Vision und genauem Hinschauen, sondern die Perspektive erweitert sich implizit zur Frage, ob vielleicht die Menschheit selbst ‚einen Vogel hat’, indem sie ihre Grundlagen zerstört und die Tierwelt der Vernichtung anheim gibt.
Damit verknüpft sich eine weitere Dimension der literarischen Präsenz der Vögel im Werk Vogts: die Vogelwelt als herausragendes Beispiel der Bedrohung der Natur durch den zivilisatorischen Druck, und insbesondere durch Gifte wie DDT. Vogt kannte als Ornithologe das 1962 erschienene Buch von Rachel Carson, Silent Spring, das die Folgen des Pestizid-Einsatzes für die Vogelwelt und indirekt für die Menschen drastisch schildert, wie auch den 1972 publizierten Bericht des Club-of-Rome Die Grenzen des Wachstums. Vogts Beschäftigung mit den Vögeln verbindet sich also mit der Sorge um die Natur und ihre Zerstörung durch Umweltgifte, wie dies exemplarisch seine Erzählung Ornizid46 offenbart. Dort kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung eines Ehepaars ‒ wiederum Einfamilienhausbesitzer, wie in Diät: Er wirft ihr vor, einen Wendehals ermordet zu haben, sie verteidigt sich, er habe ein eigenes Haus gewollt und ihr die Pflege des Gartens überlassen, so müsse sie halt Insektizide einsetzen können: «Der Garten war die Visitenkarte. Da brauchte man eben gewisse Präparate: Baum- und Strauchvertilger, Schneckengift, verschiedene selektive Dünger, Unkrautvertilger für den Rasen, Insektizid.»47 Doch geht Vogt in satirischer Zuspitzung darüber hinaus: Im Giftschrank des Paares steht auch das Mittel «INSTANT VOGELTOD Universal-Ornizid»48 Die Groteske mündet schließlich in einem gegenseitigen Mord des Ehepaars, wobei zur Mordwaffe das Insektengift wird: Die Linie führt vom gebräuchlichen «Insektizid» zum entlarvenden «Ornizid» und implizit anschließend kritisch-satirisch weiter zum ‚Homizid’. Waren die Grenzen zwischen Tier und Mensch bisher in metaphorischer Weise aufgelöst, so wird, wenn das Vogelgift beim Menschen genau so gut wirkt, die ‹anthropologische Grenze› auch konkret überschritten. Auch der Mensch ist nur ein Vogel. An diesem Punkt der Erzählung tritt unvermittelt das «Ich» auf, das beschließt, «das Ganze ein wenig unter die Lupe zu nehmen.»49 Dieses Ich, das sich ironisch mehrfach verortet, extradiegetisch als «allwissenden Ich-Erzähler»50, intradiegetisch als eine Art Privatdetektiv, untersucht im Kontakt mit Kommissar Zwicky den Fall, und zugleich tritt es als Psychiater mit biografischen Zügen Vogts auf. Als Privatdetektiv besucht dieser Ich-Erzähler einen Kollegen und Hobby-Ornithologen, der alles über Wendehalse und Wiedehopfe weiß, aus Fachbüchern zitiert und selbst vogelhafte Züge annimmt. Und auch diese Szene ist mit einem autofiktionalen, autoironisch angelegten Verwirrspiel verbunden:
«Wenn die Insekten nicht schädlich wären», zitierte der Kollege, «wären die Vögel nicht nützlich.» So einfach war das also. Mir kam es vor, als hätte ich den Spruch schon irgendwo gelesen oder gehört. «Mein Kollege», sagte der Doktor und wies unbestimmt Richtung Stadt, «Mein Kollege hat als Gymnasiast» ‒ er betonte feierlich das Wort und ließ es auf seiner Spechtvogelzunge zergehen ‒ «als Gymnasiast das sogenannte Zirkeln beim Wiedehopf beschrieben ‒ 1944, damals gab es noch gar keine Verhaltensforschung. Das heißt, Verhaltensforschung schon, aber das Wort gab es noch nicht. Heute macht er Psychiatrie und schreibt…» «Darum also war der Spruch mir so bekannt vorgekommen. Er war von mir.»51
Die Kritik am anthropozentrischen Sprachgebrauch und der utilitaristischen Perspektive in der Wissenschaft ist auch in der parabelhaften Satire Nutzen und Schaden titelgebend. Im Zentrum stehen die Firma «Idiochemie» und ihre Vertreter mit den sprechenden Namen Nüsslin und Schädelin, die von der Produktion von «Herbiziden, Pestiziden, Insektiziden» zu jener von «Orniziden, kurz: Bioziden»52 übergeht. Ist insgesamt das zerstörerische Umweltverhalten der westlichen Zivilisation Thema der Satire, so wird zugleich auch eine Metaebene einbezogen, in der das zivilisations- und wissenschaftsgeschichtliche Verhältnis von Mensch und Vogel in seinen Grundlagen in den Fokus gerät. Der Erzähler verweist beispielsweise darauf, dass der berühmte Brehm (Brehm’s Tierleben) in der «zweiten Auflage des Leben der Vögel von 1867 emotional reagierte und seiner blinden Wut auf den König der Nacht, den Uhu, freien Lauf ließ»53. Er zitiert auch E. Liers Deutschlands Vögel: Ihr Nutzen und Schaden von 1884. Dabei wird der Fokus auf die Geschichte der ornithologischen Forschung wie auf die aktuelle Kommunikation als Sprachkritik konkretisiert, die den anthropozentrischen Blick bloßstellt und die vermeintlich wertneutrale Wissenschaftlichkeit als Illusion entlarvt.
Wird in der Satire Nutzen und Schaden das Nützlichkeitsdenken und die Trennung von Mensch und Natur durch die unbedachten Konsequenzen bloßgestellt, so werden im Roman Altern, der in Vogts literarischem Werk das ornithologische Interesse des Autors am kontinuierlichsten bezeugt, diese Grenzen nochmals und diesmal grundsätzlicher reflektiert. Das als «Roman» bezeichnete Werk bildet eine Selbstbeobachtung sub specie mortis und gleicht formal eher einem Journal oder literarischen Tagebuch, ähnlich wie Paul Nizons ebenfalls 1981 publizierter «Roman» Das Jahr der Liebe. In den Teilen «Später Sommer», «Herbst» und «Tiefer Winter» folgt Altern dem Jahreslauf und schließt mit einer «Coda», die wiederum im ‚späten Sommer’ des darauffolgenden Jahres situiert ist, was insgesamt einen Zeitraum von ca. 14 Monaten ergibt. Der Erzähler, für einmal unverkennbar mit dem Autor identisch im Sinne eines autobiografischen Pakts und ohne autofiktionale Verwirrspiele, hält sich in der warmen Zeit in der kleinen Wohnung am Murtensee auf, oft zusammen mit dem Schriftstellerfreund «C.»54, in der kalten Jahreszeit ist er dagegen mit seiner Frau zuhause in Muri bei Bern. Der Text enthält längere autobiografische Rückblicke, daneben die exakte Bestandesaufnahme und Beobachtung des eigenen Körpers, des Umfeldes, des Freundes, der Wohnung, des Schreibtisches am See und in Muri.
Es ist bemerkenswert, welche Fülle von Vögeln der Autor in Altern kenntnisreich beschreibt oder aus der Erinnerung kommentiert; er beobachtet die Vögel nicht nur bei der Wohnung am Murtensee, sondern geht auch regelmäßig ins Vogelschutzgebiet La Sauge, auf den Damm des Broyekanals, der den Murten- mit dem Neuenburgersee verbindet und unter Ornithologen als guter Beobachtungsort bekannt ist.55 Folgende Vögel kommen in Altern vor ‒ ungefähr in der Reihenfolge der Nennung: Nachtigall, Blaukehlchen, Schwan, Silber- und Lachmöwe, Reiher, Ente, Haubentaucher, Krähe, Bläßhuhn, Pirol, Milan, Schleiereule, Schwalbe, Elster, Star, Kolkrabe, Flamingo, Kiebitz, großer Brachvogel, Falke, Seeadler, Wiederhopf, Steinkauz, Waldkauz, Zwergohreule, Sperber, Habicht, Zwergrohrdommel, Eisvogel, Häher, Meise, Kranich, Taube, Mauersegler, Kirschkernbeißer, Buchfink, Schwirl, Heckenbraunelle, Grünspecht, Schwalbe, Flussuferläufer, Pirol, Stieglitz, Storch, Bachstelze, Grauschnäpper, Garten- und Hausrotschwanz, Steinschmätzer, Wespenbussard, Erlenzeisig, Rotkehlchen, Haus- und Feldsperling, Drossel, Kiebitzregenpfeifer; zudem ‒ mit Bezug auf den Aufenthalt in Los Angeles ‒ Kolibri, Pelikan, Mocking bird (amerikanische Spottdrossel), Blackbird (amerikanische Amsel), Heermann’s Gull (eine Möwenart) und eine nicht identifizierte Regenpfeifer-Art. In dieser Vielfalt wird deutlich: Die Kenntnis der Arten und ihres Verhaltens ist Voraussetzung für den genauen Blick und für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge von zivilisatorischen Entwicklungen und Naturprozessen.
Exemplarisch sei eine Passage genannt, in der dem Ich-Erzähler ein «ungewohnter kleiner Vogel auf dem Steg» auffällt. Bei der Identifizierung des Vogels schwankt er zwischen Nachtigall und Blaukehlchen und benennt letzteres schließlich mit dem Fachnamen «Luscinia (Cyanosylvia) svecica, Schwedische Nachtigall»:
«Ich werde nun nie wissen, wer dieser erste Vogel des Tages wirklich war. So weit kenne ich mich noch immer aus, um zu wissen, daß nur diese beiden in Frage kommen (…). Ich könnte die Art mit einer gewissen, möglicherweise an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bestimmen, wüßte ich die mittleren und extremen Zugdaten beider Vögel genau. Dazu müßten allerdings die Singvogelbände des Handbuch der Vögel Mitteleuropas erschienen sein. Aus dem kurzgefaßten Buch Die Brutvögel der Schweiz geht einzig hervor, daß beides durchaus möglich, durchaus wahrscheinlich ist.»56
Im «Coda»-Herbst beobachtet der Erzähler hingegen nach Süden ziehende Vögel: «Mir kommt vor, ich hätte den Vogelzug noch nie derart plastisch gesehen: es ist, als seien ganze Vogelbevölkerungen ins Rutschen geraten, verschöben sich nun … Winterwärts. Wieviel muß man wissen, um so viel zu sehen?»57 Das Wissen über die Vögel ermöglicht auch erst den Blick auf das Verhängnis ihrer ‒ immer wieder angesprochenen ‒ Bedrohung durch menschliche Gifte: Die «Verschmutzungskette»58 zeugt zugleich von der Verflechtung von Mensch und Tier:
«Steinkauz und Zwergohreule wie weggeblasen. Ich habe sie Frühjahr um Frühjahr in der Provence gesucht ‒ traute erst meinen Sinnen nicht, meinte dann, zu früh oder zu spät im Jahr gekommen zu sein, bis ich endlich glaubte, daß sie tatsächlich am Aussterben sind. Man muß wissen: 1949/50 flötete noch eine der kleinen Eulen auf jedem Telefonmast in Arles. Wegen eines Steinkauzes, Vogel der Athene, sah man sich nicht einmal um, weil es den zu Hause ebenfalls gab.»59
Doch der Titel des Tagebuch-Werks ist Altern, und es ist als «Roman» bezeichnet. Sein Thema ist somit die körperliche Selbstbeobachtung, die den kaum merklichen, und doch unaufhaltsamen Alterungsprozess widerspiegelt. Dies führt Walter Vogt recht weit aus in einem autobiografischen Rückblick, der in vielem als eine Geschichte des eigenen Körpers und seiner Krankheiten und Gebrechen entwickelt wird. Dies verleiht dem Roman eine barocke Dimension der Hinfälligkeit des Menschen. Die eigene Körperlichkeit bleibt jedoch nicht, wie man zunächst meinen könnte, egozentrisch bzw. anthropozentrisch beschränkt, sie wird mit jener des Makrokosmos in Verbindung gebracht. Das zyklische Bild der Natur sei von der Evolutionstheorie ausgeräumt worden: «Es wandelt sich, es altert auch die Natur»60 oder «Es altert der Mensch, und es altert die Natur.»61 Unter diesem Blickpunkt wird somit der eigene körperliche Alterungs- und Verfallsprozess Teil eines globalen Prozesses mit asynchronen Verläufen: «Kleinere Vögel altern rascher als große.»62
Dem Roman Altern ist ein «Vorspruch» vorangestellt, in dem als Phänomen der bis zu 15 Meter hohe Saguaro-Riesenkaktus aus Nordamerika vorgestellt wird. Dieser Riesenkaktus trägt mit fünfunddreißig Jahren erstmals Blüten, treibt mit vierundsechzig bis hundert Jahren die ersten Seitenäste und entwickelt sich so zu einem eigenen Kosmos mit von ihm abhängigen Insekten und Vögeln: «Zwei Spechtartige bauen ihre Höhlen ausschließlich in Saguaros. Eine kleine Eule bezieht beinahe ausschließlich die verlassenen Höhlen dieser Spechtvögel.» Kurzum: «Es gibt eine ganze Saguaro-Welt», aber sie ist «vermutlich zum Aussterben verdammt. Ihr Feind ist der Mensch.»63 ‒ Mit dem Einbezug des menschlichen Alterns in andersartige Alterungsprozesse in der Natur vollzieht Vogt, wenn man so will, avant la lettre, einen animal turn, wie er für die kulturwissenschaftliche Forschung in den Jahren nach der Jahrtausendwende beobachtet wird. Verbunden ist dies mit einer Relativierung und Infragestellung der «anthropologischen Differenz» von Mensch und Tier und einer «Neufassung der theoretischen, methodischen und begrifflichen Prämissen der eigenen Disziplin (…). Denn die Argumente, mit denen die Eindeutigkeit einer anthropologischen Differenz in Frage gestellt wird, führen zu einer Neubewertung nicht nur der Tiere, sondern zugleich auch der Menschen, und dies heißt, in letzter Konsequenz, zu einer Revision des eigenen Standorts mit seinen herkömmlichen Konzepten, Begriffen, Methoden und Theorien.»64
Die von Walter Vogt seit seiner Kindheit gepflegte ornithologische Beobachtung steht zum einen stellvertretend für den genauen modern-wissenschaftlichen, objektivierenden Blick auf die Natur. Das Benennen der Naturphänomene ist zugleich ein Zeichen der geistigen Durchdringung der Natur, der Kenntnis sowie in der Konsequenz auch der Beherrschbarkeit und Nutzbarmachung. Zum anderen hat Vogt allerdings in seinen Satiren den wissenschaftlichen Blick kenntnisreich in Frage gestellt, insbesondere ‒ wie dargelegt ‒ in den um die Metapher des «Vogels» konstruierten Verwirrspielen und Inversionen von Wissen und Wahn, von Psychiatrie und Geisteskrankheit. Damit thematisiert er konkret, was Max Horkheimer und Theodor W. Adorno als «Dialektik der Aufklärung» eines aufklärerische Rationalität und instrumentelle Vernunft in vielfältigen Gestalten und Perversionen verbindenden modernen Denkens analysiert haben. Es gehört zu den Abgründen der Wissenschaftsgeschichte, dass Günther Niethammer zum Zeitpunkt, als der begeisterte jugendliche Vogelbeobachter Walter Vogt 1943 sein Handbuch der deutschen Vogelkunde konsultierte (vgl. Anm. 6), seine ornithologischen Beobachtungen als SS-Wachmann in Auschwitz weiterverfolgte.65 Ob Vogt später davon erfuhr, ist nicht belegt.
Vogts Konsequenz aus den Perversionen des modernen Wissens, die er satirisch blossstellt, ist nicht eine Absage an Wissenschaft und Aufklärung: Die Voraussetzung für die Überwindung des objektivierenden wissenschaftlichen Blicks, der die Natur zum verdinglichten Gegenüber macht und zum kurzfristigen menschlichen Nutzen missbraucht, ist ein Verständnis des Menschen als Teil eines globalen Naturprozesses auf der Grundlage einer vertieften und genaueren wissenschaftlichen Perspektive auf die komplexen Natur-Phänomene, die den Menschen nur insofern aus den Naturzusammenhängen heraushebt, als er mit seinen technischen Mitteln jenes Anthropozän hergestellt hat, das auch für den Untergang unzähliger Vogelarten verantwortlich ist. In den 43 Jahren seit dem Erscheinen von Altern hat die Weltbevölkerung um 75 % zugenommen, der Vogelbestand im Agrarland hat indes in Europa im gleichen Zeitraum um 57% abgenommen.
Literaturverzeichnis
- Vogt, Walter: Altern. Roman. Einsiedeln 1981, S. 130. ↩
- Vogt, Walter: Junge Entchen. In: Der Schweizer Schüler, Illustrierte Familienwochenschrift, 18. Jg., Nr. 46, 15.11.1941, S. 1107. Belegeexemplare dieser und der weiteren angeführten Zeitschriften-Nummern finden sich in Vogts Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv unter der Signatur SLA-Vogt-D-1-b/1. ↩
- Vgl. Vogt, wie Anm. 1, S. 145. ↩
- Vogt, Walter: Ueber Bruten von Turdus merula L., Ueber eine Brut von Carduelis cannabina L., in: Der ornithologische Beobachter. Offizielles Organ der ALA. Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz. 40. Jg., H. 9/10: Sept./Okt. 1943, S. 129-131. ↩
- In Vogts nachgelassener Bibliothek steht noch Band 85, Heft 3, 1988; darauf von seiner Witwe Elisabeth Vogt die Notiz: «letztes Heft. Abo + Mitgliedschaft abgesagt Okt. 88». Walter Vogt war am 21.9.1988 gestorben. ↩
- Er bezieht sich auf Niethammer, Günther: Handbuch der deutschen Vogelkunde, Bd. 1: Passeres, Leipzig, 1937. ↩
- Vogt, Walter: Über die Territorien der Wasseramsel, Cinclus cinclus (L.), im Winter 1943/44 an der Aare bei Bern. In: Der ornithologische Beobachter. 41. Jg., Bern, März/April 1944, Heft 3/4, S. 36-43. ↩
- Vogt. Walter: Über einige Feldbeobachtungen an Wiedehopfen (Upupa epops L.). In: Der ornithologische Beobachter 41. Jg., Bern, August/September/Oktober 1944, Heft 8/9/10, S. 110 f.. ↩
- Vogt. Walter: Soziale Schlafgewohnheiten von Sturnus vulgaris L., Typoskript, 11 Seiten, Signatur SLA-Vogt-D-1-b/1. ↩
- Zu Vogts 50. Geburtstag erinnerte sich der Arzt Niklaus Brüschweiler, wie er als Progymnasiast auf der gemeinsamen Exkursion in die Camargue vom Medizinstudenten Walter Vogt in Obhut genommen wurde, der ihm die Ornithologie als höheres Naturverständnis, als Gesamtwahrnehmung von Natur in Menschenferne und Menschennähe vermittelt habe. Vgl. Ms. im Nachlass, Signatur SLA-Vogt-B-4-c/1d. ↩
- Brief Schweizerische Vogelwarte Sempach (A. Schifferli) an Walter Vogt, 31.10.1968, Signatur SLA-Vogt-B-4-a/05. ↩
- Gespräch Elisabeth Vogt mit Fredi Lerch und Verf., Muri b. Bern, 2.4.2024. ↩
- Vgl. Vogt, wie Anm. 1, S. 198. ↩
- Nachlass Walter Vogt, Schweizerisches Literaturarchiv, Signatur SLA-Vogt-E-2-e. Die Bücher sind nicht einzeln katalogisiert. ↩
- Noll, Hans: Schweizer Vogelleben. 2 Bde., Basel 1941/1942. Widmung in Bd. 1. ↩
- Auch die in unserem Motto aus dem Roman Altern angeführten, in Los Angeles als Writer in residence gekauften Birds of North America sind in der ornithologischen Nachlass-Bibliothek erhalten: Robbins, Chandler S., Bruun, Bertel and Zim, Herbert S.: Birds of North America. New York s.d. Auf der Titelseite notiert Vogt unter seinem Eigentümer-Namen: «Santa Monica 14.2.78» ↩
- S. 130. ↩
- Alle 3 Hefte unter der Signatur: SLA-Vogt-C-1-c/03. ↩
- Vgl. ebd., S. 10. ↩
- van Hoorn, Tanja: Ornithophonia, Ornithopoesie, Ornithopoetik: Zur ästhetischen Produktivität der Vogelkunde von Nikolaus Bähr bis Friederike Mayröcker. In: dies. (Hg.): Avifauna aesthetica. Vogelkunden, Vogekünste. Göttingen 2021, S. 36-52, hier S. 36. ↩
- Eggers, Michael: Vogelprosa. Zur Präsenz der Vögel in der narrativen Gegenwartsliteratur. In: van Hoorn (Hg.), wie Anm. 20, S. 231-248, hier S. 233. ↩
- Nachlass Vogt, Signatur SLA-Vogt-B-2-MAR. ↩
- Dossier zum 50. Geburtstag, Signatur SLA-Vogt-B-4-c/1d. Vgl. Vogt, Walter: Der Vogel auf dem Tisch (Zürich 1968, Neuausgabe Zürich 1978). ↩
- Nachlass Kurt Marti, Signatur SLA-K.MARTI-B-02-VOGT. Ich danke Lukas Dettwiler für den Hinweis. ↩
- Vogt, Walter: Der Vogel auf dem Tisch (Zürich1968, Neuausgabe Zürich 1978). ↩
- Vogt, Walter: Kuckuck in ders.: Metamorphosen (Zürich 1984) beschreibt kenntnisreiche die Beobachtung eines flüggen Jungkuckucks bei seinem Weg in die Selbständigkeit von den Bachstelzen-Pflegeeltern. ↩
- In: Stimm bruch. Zeitschrift für Lyrik und Prosa Nr. 7, September 1969 [unpaginiert]. ↩
- «Mamali wollte für sein Papali und für sich selbst nicht irgendwelche Eier, sondern frische, auch nicht Eier von geplagten, gequälten, seelisch verstümmelten Batteriehühnern (…). Mamali suchte nach Eiern von glücklichen Hühnern, die um ein Bauernhaus herumgackern, nach Körnern und wilden Kräutern picken und ihre Eier sorgfältig verstecken, trotz ihrem triumphalen Gegacker, wenn sie eines gelegt, so wie ein Huhn eben ist, ein Vogel, nicht eine Eierfabrik.» Vogt, Walter: Diät. In: ders.: Die roten Tiere von Tsavo. Erzählungen, Zürich 1976, S. 126-181, hier S. 148. ↩
- Ebd., S. 157 f. ↩
- Ebd., S. 158. ↩
- Vogt, Walter: Die roten Tiere von Tsavo, in ders.: wie Anm. 28, S. 182-203, hier S. 188. ↩
- Ebd., S. 188 f. ↩
- «Einen Vogel haben (…): nicht ganz bei Verstand sein, eine fixe Idee haben, närrisch sein; umg. und mdal. vielfach bezeugt. Nach altem Volksglauben wird die Geistesgestörtheit durch Nisten von Tieren im Kopf verursacht. Die zugrunde liegende Vorstellung zeigt sich auch in parallelen Wndgn., wie ‚Bei dir piepts wohl?’, auch: ‚Dich pickt wohl der Vogel?’» (Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten Freiburg, Basel, Wien, 2001 ,5. Aufl., S. 1679). ↩
- Vogt, wie Anm. 31, S. 188. Das Buch steht in Vogts Nachlass-Bibliothek: Williams, John G.: Die Vögel Ost- und Zentralafrikas. Ein Taschenbuch für Ornithologen und Naturfreunde. Hamburg und Berlin 1969 (4. Aufl.), mit einem Besitzeintrag «Vogt 75». Das Zitat mit Seitenangabe ist authentisch. Daneben findet sich auch Führer zum Tsavo- und Serengeti-Park und das Buch Sheldrick, Daphne: The Tsavo Story, London 1973. Vogt war tatsächlich 1975 in den beiden Parks. Einiges aus den Schilderungen über die Dürre und ihre katastrophalen Folgen für die Großsäuger nimmt Vogt in der Erzählung allerdings aus der genannten Publikation von Sheldrick. ↩
- Ebd., S. 189. ↩
- Ebd., S. 182. ↩
- Ebd., S. 184. ↩
- Ebd., S. 187. ↩
- Ebd., S. 186. ↩
- Ebd., S. 187. ↩
- Ebd., S. 189. ↩
- Ebd. ↩
- In der Kurzbiografie zu Beginn des KLG-Beitrags zu Walter Vogt heißt es: «Private Interessen: Ornithologie, Bibeluntersuchungen des A.T.» (KLG, Art. Walter Vogt, S. 1). ↩
- Ebd., S. 193. ↩
- Ebd., S. 194. ↩
- Vogt, Walter: Ornizid. Erstmals erschienen im Band Booms Ende, hier zitiert nach: Vogt, Walter: Die roten Tiere von Tsavo. Erzählungen und Gedichte. Werkausgabe, Bd. 7, hg. von Charles Cornu, Zürich 1994, S. 306-326. ↩
- Ebd., S. 309. ↩
- Ebd., S. 315. ↩
- Ebd., S. 311. ↩
- Ebd., S. 316. ↩
- Ebd., S. 312 f. Der zitierte Aphorismus findet sich tatsächlich handschriftlich vorne in Vogts Exemplar des Buchs Deutschlands Vögel: Ihr Nutzen und Schaden, im Interesse des Vogelschutzes herausgegeben von E. Lier. Langensalza, Schulbuchhandlung Greßler, s.d.: «Wenn die Insekten nicht schädlich wären / wären die Vögel nicht nützlich.- 73» und darunter noch einmal in Mundart: «We t’Insekte nid schädlech wääre / wääre Pfögu nid nüzzlech… 73». Zum erwähnten Forschungsbeitrag des «Kollegen» von 1944 über die Wiederhopfe vgl. Anm. 8. ↩
- Vogt, Walter: Nutzen und Schaden. Erstmals erschienen im Band Booms Ende, hier zitiert nach: Vogt, wie Anm. 46, S. 244-261, hier S. 245. ↩
- Ebd., S. 247. In Vogts entsprechender Brehm-Ausgabe kann man nachlesen: «Es ist kaum zweifelhaft, daß [der Uhu] wirklich mehr schädlich als nützlich ist.» (S. 384) Und: «Schwächere Vögel fällt er mörderisch an, erwürgt sie und frißt sie dann mit größter Gemütsruhe auf.» (S. 385) ↩
- Hinter «C.» steht biografisch der Jungautor Christoph Geiser. ↩
- Vgl. Schweizer. Manuel, Walser Schwyzer, Paul, Ritschard, Mathias und Sacchi, Marco: Vögel beobachten in der Schweiz. Bern 2020 (4. Aufl.), S. 72-79. ↩
- Vogt, wie Anm. 1 , S. 39. Vogt bezieht sich einerseits auf Glutz von Blotzheim, Urs N.: Die Brutvögel der Schweiz, hg. von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach, 2. Aufl. Aarau: Verlag Aargauer Tagblatt, 1962 (in Vogts Bibliothek vorhanden), andererseits auf das große von Urs N. Glutz von Blotzheim herausgegebene: Handbuch der Vögel Mitteleuropas, das ab 1966 über 32 Jahre hinweg in 14 Bänden erschien. ↩
- Vogt, Altern, S. 274. ↩
- Ebd., S. 54. ↩
- Ebd., S. 70. ↩
- Ebd., S. 20. ↩
- Ebd., S. 30. ↩
- Ebd., S. 31. ↩
- Ebd., S. 5. ↩
- Borgards, Roland: Einleitung: Cultural Animal Studies, in: ders. (Hg.): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch. Stuttgart 2016, S. 1-5, hier S. 4. ↩
- Vgl. Surminski, Arno: Die Vogelwelt von Auschwitz, München 2008, und Eggers. Michael: Vogelprosa. Zur Präsenz der Vögel in der narrativen Gegenwartsliteratur. In: van Hoorn (Hg.), wie Anm. 20, S. 231-248, hier: S. 237-240. ↩